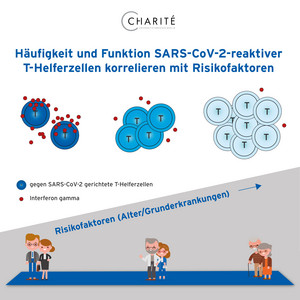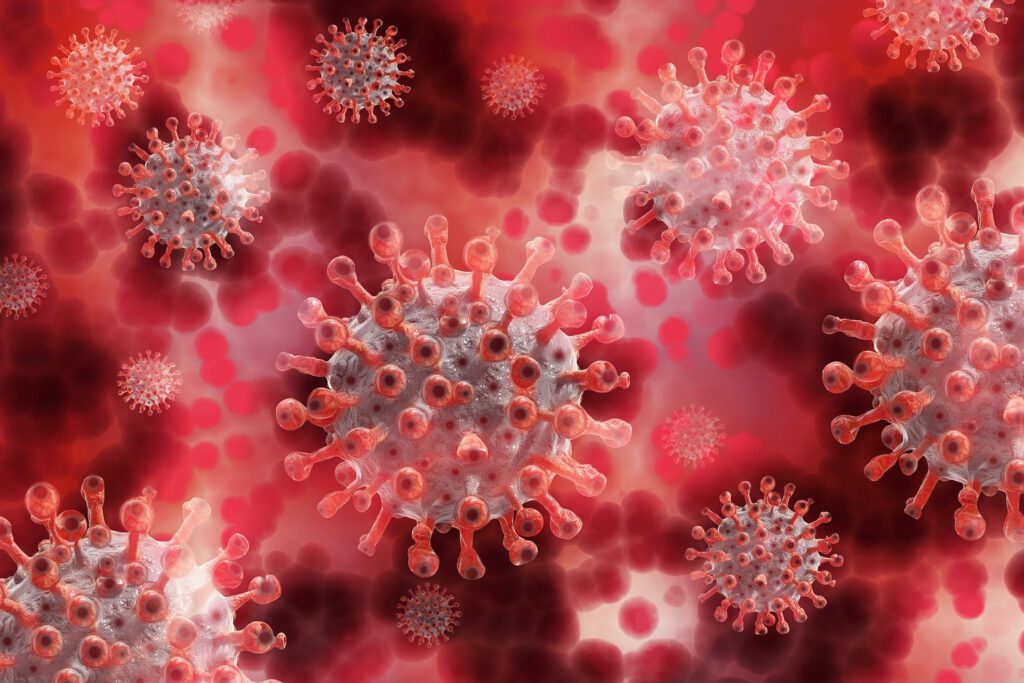Die Züge der Bahn verfügen über keine Virenfilter
Immer vollere Züge, immer weniger Abstand zwischen Bahn-Reisenden. Zugbegleiter und Experten warnen im ARD-Magazin MONITOR vor einem steigenden Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2.
„Alle sind in Deutschland unterwegs, alle sind hier unterwegs mit der Deutschen Bahn zu ihren Reisezielen. Also, die Züge werden immer voller“, beschreibt Christian Deckert die aktuelle Lage. Er ist Zugbegleiter, Mitglied im Bezirksvorstand NRW der Lokführergewerkschaft GdL und sorgt sich um die Gesundheit seiner Kollegen und Kolleginnen und die der Reisenden.
Die Sorgen sind nicht unberechtigt. Eine neue Studie aus China zeigt: Je weniger Abstand zwischen Bahnreisenden ist und je länger die Reise dauert, umso höher ist auch das Risiko sich mit dem Corona-Virus zu infizieren. Es sei „eine bemerkenswerte Studie“, sagt Professor Gerard Krause, Epidemiologe vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, vor allem weil sie einen wichtigen Zusammenhang belege: „Je größer der Abstand, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand anderes infiziert.“ Die Bahn sieht die Studie als Bestätigung für die Maskenpflicht in den Zügen. Allerdings halten sich viele Reisende nicht daran. „Wenn man durch jeden Wagen geht, bei jedem Gang, den man da durchgeht“ komme das „mindestens fünf Mal auf jeden Fall“ vor, sagt Zugbegleiter Deckert. Eine Handhabe gegen die Reisenden haben die Bahnmitarbeiter nicht. Sie können die Maskenverweigerer nicht des Zuges verweisen. Dies dürfte nur die Bundespolizei, die aber nicht über das ausreichende Personal verfügt, um die Maskenpflicht in den Zügen auch durchzusetzen.
Und dann gibt es da noch ein Problem: Die Klimaanlagen. Nach Aussage der Bahn drohe hier keine Gefahr, da die „Schienenfahrzeuge eine hohe Luftwechselrate aufweisen“ würden und „sehr viel Frischluft zugeführt“ werde. Eine Übertragung von Viren durch die Klimaanlagen halte man für „äußerst unwahrscheinlich“.
Anders als in Flugzeugen verfügen die Züge der Bahn allerdings über keine Virenfilter. Inwieweit dadurch ein erhöhtes Infektionsrisiko auch über Aerosole besteht, will die Bahn erst noch erforschen, obwohl sich das Problem wohl schon im Winter verschärfen dürfte. Denn je mehr die Luft in den Zügen erhitzt werden muss, umso höher ist der so genannte Umluft-Anteil und umso weniger Frischluft wird zugeführt. Genau darauf komme es aber an, sagen Experten, wie Markus Hecht, Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge an der TU Berlin: „Man sollte den Umluftanteil so klein wie möglich halten. Es wird nur gerade im Winter nicht ohne gehen, weil sonst die Temperaturen zu sehr absinken. Und deshalb müssen wir die Zeit bis zum Winter nutzen, um da die Anlagen noch zu verbessern.“
Außerdem sei die mangelnde Zuverlässigkeit der Klimaanlagen „ein riesiges Problem“, sagt Hecht gegenüber MONITOR. „Ich würde ganz dringend empfehlen, wenn eine Anlage ausfällt, diesen Wagen zu räumen, den Zug zu räumen.”
Trotz all dieser Probleme, trotz noch unerforschter Risiken: Die Bahn setzt auch in Corona-Zeiten weiter auf stärkere Auslastung. „Während der Reise unterstützt zudem das Bordservicepersonal die Kunden dabei, sich innerhalb der Züge bestmöglich zu verteilen“, heißt es. Gewerkschaftsvertreter halten das für unverantwortlich. Claus Weselsky, Vorsitzender der Lokführergewerkschaft GdL, fordert eine allgemeine Reservierungspflicht, um überfüllte Züge zu vermeiden und Abstandsgebote einhalten zu können.
„Mit einer Reservierungspflicht könnten wir zumindest mal sicherstellen, dass nie mehr als hundert Prozent der Sitzplätze tatsächlich vergeben sind. Man sollte nicht davon träumen, von überfüllten Zügen die Fahrgeldeinnahmen zu haben und dabei unsere Kolleginnen und Kollegen einem höherem Risiko auszusetzen.“
Vorbilder dafür gäbe es. In Italien darf niemand ohne eine Reservierung einen Fernzug besteigen. Dort bleiben auch viele Sitze frei. Aber die Deutsche Bahn lehnt einen solchen Vorschlag ab. Man wolle an dem „offenen System, das Bahnkunden in Deutschland sehr schätzen“, festhalten. Stand: 20.08.2020, 06.00 Uhr
Die ZDF-Sendung Markus Lanz am 19.08.2020
Der Physiker Prof. Christian Kähler erklärt sehr anschaulich in der Sendung von Markus Lanz am 19.08.2020, weshalb es wichtig ist, dass die Klimaanlagen funktionieren und Virenfilter haben. Von der Bahn kennen wir allerdings, dass besonders an den heißen Tagen die Klimaanlagen oft nicht funktionieren. Die Maskenverweigerer sind leider überall unterwegs, wenn keine Konsequenzen drohen, dann macht man es ihnen auch recht einfach.
Prof. Christian Kähler, Physiker
Er spricht über die Erzeugung und Verdunstung von Aerosolen, die maßgeblich zur Übertragung von Viren beitragen. Und er äußert sich zur Wirksamkeit von Masken und Raumluftfiltern.
Sven Plöger, Meteorologe
Der Sommer ist geprägt von Temperaturrekorden und Trockenheit. Plöger erklärt die Ursachen des Klimawandels, und er erläutert, wie sich das Wettergeschehen zukünftig entwickeln wird.
Dr. Jördis Frommhold, Pneumologin
Die Chefärztin einer Rehaklinik in Heiligendamm berichtet über die Behandlung von COVID-19-Patienten und über die vielfältigen Spätfolgen von Corona-Infektionen.
Stephan Weil, Politiker
Der Ministerpräsident Niedersachsens und SPD-Politiker äußert sich zur Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens, den Umgang mit Urlaubsrückkehrern und zu seiner Strategie in der Krise.
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-19-august-2020-100.html#xtor=CS5-95