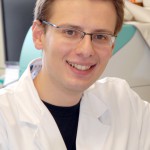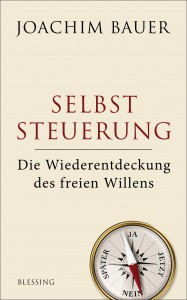Bluthochdruck: Was Ur-Ozean, unsere Gene, Salz und Fett mit dem „stillen Killer“ zu tun haben
Interview mit dem Bluthochdruck-Experten Prof. Dr. Detlev Ganten zum Welt Hypertonie Tag am 17. Mai 2015
20 bis 30 Millionen Menschen haben allein in Deutschland einen zu hohen Blutdruck – das ist fast jeder dritte. An den Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sterben laut Weltgesundheitsorganisation WHO jedes Jahr weltweit über neun Millionen Menschen. Das große Problem: Die meisten wissen nicht einmal, dass sie bereits erkrankt sind. Bluthochdruck (Hypertonie) gilt als „stiller Killer“.
Dabei ist es einfach, Bluthochdruck zu erkennen, zu behandeln und sogar zu vermeiden. Was jeder Einzelne tun kann, erklärt Professor Dr. Detlev Ganten. Er ist weltweit einer der führenden Bluthochdruck-Forscher, Facharzt für Pharmakologie und Molekulare Medizin, sowie Experte für Evolutionäre Medizin. Außerdem ist er Präsident des World Health Summit, der jährlichen internationalen Weltgesundheitskonferenz in Berlin.
Professor Ganten, Bluthochdruck ist zu einem weltweiten Gesundheitsproblem geworden. Wie konnte dies geschehen? Mediziner forschen doch seit Jahrzehnten zu diesem Thema.
Es stimmt: Wir befassen uns seit Jahren mit der Erforschung des Herz-Kreislauf-Systems und den medizinischen Zusammenhängen von Bewegung, Gesundheit und Bluthochdruck. Auch die Bedeutung unserer genetischen Erbanlagen wird immer wichtiger. Die Antwort allerdings liegt in unserer evolutionären Entwicklung: Wir Menschen sind auf Salz, Fett und Zucker fokussiert. Fett gab unseren Vorfahren Reserven für schlechte Zeiten, Zucker schnelle Energie in Gefahrensituationen und Salz ist für den Blutkreislauf essenziell. Wir leben bis heute mit diesem System, das auf ein Leben und Überleben als Jäger und Sammler ausgerichtet ist. Allerdings passt das überhaupt nicht mehr in unsere moderne Welt, in der die Hälfte aller Menschen in Städten leben und wir uns viel zu wenig bewegen. Wir nehmen heute deutlich mehr Salz, Zucker und Fett zu uns, als wir verbrauchen. Das treibt den Blutdruck in die Höhe. An den Folgeerkrankungen sterben jedes Jahr Millionen Menschen.
Die genaue Wechselwirkung von Bluthochdruck und Salz ist bis heute ein Geheimnis für die Wissenschaft: Warum treibt Salz bei dem einen den Blutdruck in die Höhe, bei dem anderen nicht?
Auch hier kommt die Antwort aus der Evolution: Beim Gang an Land, vor etwa 400 Millionen Jahren, als Amphibien, Reptilien und später auch unsere näheren Vorfahren entstanden, entwickelte sich ein Organ, dessen Konstruktionspläne auch heute noch den Blutdruck regulieren: Das Filterorgan Niere. Es sorgt dafür, dass überschüssiges Salz mit dem Urin aus dem Körper geschwemmt wird. Unsere Zellen sind aber bis heute an die Konzentration der Salze im Ur-Ozean angepasst. Unablässig befördern kleine Pumpen auf der Zellmembran Salze nach innen und wieder hinaus. Das wird durch unsere Gene geregelt, die aber bei jedem Menschen ein wenig anders sind. Darum reagieren die einen mehr und die anderen weniger empfindlich auf Salz.
Wie kann man einen so individuellen Zusammenhang eindeutig erforschen?
Die einfachste Methode besteht darin, einer Gruppe von Menschen Salz zu essen zu geben und dann den Blutdruck zu messen. Bei den salzempfindlichen Menschen steigt er an, bei den unempfindlichen bleibt er normal. Wenn man jetzt die Gene untersucht, findet man Veränderungen in der salzempfindlichen Gruppe – diese Gene müssen verantwortlich sein für den Anstieg des Blutdrucks. Bluthochdruck und Salzempfindlichkeit sind also zum Teil über die Gene vererbbar. Das kann man heute in der Forschung gut nachvollziehen.
Das klingt relativ einfach. Ist ein Durchbruch im Kampf gegen Bluthochdruck in Sicht?
Der Ansatz mag einfach klingen, die Forschung an diesem Thema ist allerdings hochkomplex. Obwohl es schon viele gute Ergebnisse und hervorragende Medikamente gibt, sollte man sich nicht auf eine medizinische Lösung verlassen. Viel wichtiger ist, dass wir noch mehr an der Aufklärung der Menschen arbeiten, denn Bluthochdruck und seinen Folgen kann hervorragend vorgebeugt werden: Selber Blutdruck messen und bei Werten deutlich über 140/90 mmHg zum Arzt gehen, mehr auf gesunde Ernährung achten und sich mehr bewegen. Anstatt zu warten, bis wir krank werden um dann zum Arzt zu gehen, sollten wir es lieber gar nicht erst so weit kommen lassen. Das ist nicht nur gesünder, sondern macht das Leben auch deutlich lebenswerter!
(Quelle: World Health Summit)
www.worldhealthsummit.org
Vom 11. – 13. Oktober 2015 findet der siebte World Health Summit im Auswärtigen Amt in Berlin statt. Er steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident François Hollande und dem Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker.
Experten aus über 80 Ländern werden Themen des G7 Gipfels im Juni in Elmau fortsetzen und auf die United Nations Climate Change Conference (COP 21) im Dezember in Paris vorbereiten. Bestätigte Sprecher sind unter anderem die Nobelpreisträger Ada Yonath (2009, Israel) und Thomas C. Südhof (2013, Deutschland), sowie Debra Jones (USA), Direktorin und UN Repräsentantin von Save the Children.