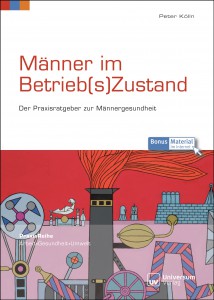Vitamine und Zink wirksam gegen Augenleiden AMD
München – Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln kann das Fortschreiten der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) in bestimmten Fällen verzögern. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) empfiehlt die Mittel nur in ausgewählten Stadien der Erkrankung und warnt in einer Stellungnahme vor Selbstmedikation. Zum Schutz vor AMD empfiehlt die DOG im Übrigen gesunde Ernährung und zur Früherkennung regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Augenarzt.
Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) betrifft etwa 4,5 Millionen Deutsche und ist damit die häufigste Erblindungsursache in den Industrienationen. Bei der feuchten Form wachsen Blutgefäße unkontrolliert in den Bereich des schärfsten Sehens auf der Netzhaut des Auges ein und zerstören unbehandelt diesen „Fleck“ – lateinisch „Makula“. Bei der trockenen Spätform sterben Sehzellen direkt ab. Die altersbedingten Schäden beeinträchtigen das Sehen erheblich, viele Betroffene erblinden im späten Stadium nahezu vollständig.
Amerikanische Studien deuten darauf hin, dass eine Kombination aus den Vitaminen C und E, Beta-Carotin, Zink- und Kupferoxid das Fortschreiten einer AMD in bestimmten Stadien verlangsamen und so die Sehkraft länger erhalten kann. „Dieser positive Effekt betrifft die Entwicklung hin zu einer feuchten Form der Erkrankung, wenn bestimmte Voraussetzungen bei den Makula-Erkrankungen erfüllt werden, die nur der Augenarzt feststellen kann“, sagt DOG-Vorstandsmitglied Professor Dr. med. Frank Holz. „Keineswegs ist die Einnahme für alle Stadien der AMD sinnvoll.“
Zur allgemeinen Vorbeugung sei der Nährstoff-Cocktail daher nicht zu empfehlen. Insbesondere bei Rauchern, auch ehemaligen, kann die zusätzliche Einnahme von Beta-Carotin das Lungenkrebsrisiko erhöhen, wie Untersuchungen zeigen. Weitere sehr seltene aber mögliche Nebenwirkungen sind Nierensteine, Magenbeschwerden, und Hautverfärbungen. „Auch AMD-Patienten sollten ihren Arzt fragen, ob eine Behandlung mit Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll ist und sich genau an die vorgeschriebene Dosierung halten“, rät der Direktor der Universitäts-Augenklinik Bonn. Diese Empfehlungen hat die DOG jetzt in einer aktuellen Stellungnahme zusammengefasst.
Um sich vor AMD zu schützen, sei es auf jeden Fall sinnvoll, nicht zu Rauchen und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. So lautet auch die Empfehlung der niederländischen „Rotterdam-Studie“. Anhand von Fragebögen dokumentieren 5836 Teilnehmer über einen Zeitraum von acht Jahren ihre Ernährung. Probanden, die eine durch Lebensmittel überdurchschnittlich hohe Zufuhr von Vitamin C, E, Beta-Carotin und Zink angaben, verringerten dadurch ihr Risiko für eine AMD um 35 Prozent. Die meisten Obst- und Gemüsesorten enthalten die Vitamine C und E. Zink ist in roten Fleischsorten, Käse und Pilzen enthalten. Auch Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel aus Fisch und Rapsöl erhalten die Sehkraft.
Bis heute gibt es kein „Heilmittel“ für die AMD. Die feuchte Form kann heute sehr wirksam mit der Verabreichung von Medikamenten, die einen Botenstoff selektiv hemmen, behandelt werden, Bei frühzeitiger Diagnose von früheren Formen kann der Augenarzt den Krankheitsverlauf verzögern um die Sehkraft so lange wie möglich zu erhalten. „Ab 50 sollte jedes Jahr ein Termin zur augenärztlichen Kontrolle im Kalender stehen“, rät“ Professor Dr. med. Christian Ohrloff, Pressesprecher der DOG. Die gemeinsame Stellungnahme von DOG, der Retinologischen Gesellschaft und des Berufsverbandes der Augenärzte in Deutschland ist im Internet erhältlich.
Literatur: Aktuelle Stellungnahme der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, der Retinologischen Gesellschaft und des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschland zu Nahrungsergänzungsmitteln bei altersabhängiger Makuladegeneration, Oktober 2014 DOG: Forschung – Lehre – KrankenversorgungDie DOG ist die medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft für Augenheilkunde in Deutschland. Sie vereint unter ihrem Dach mehr als 6500 Ärzte und Wissenschaftler, die augenheilkundlich forschen, lehren und behandeln. Wesentliches Anliegen der DOG ist es, die Forschung in der Augenheilkunde zu fördern: Sie unterstützt wissenschaftliche Projekte und Studien, veranstaltet Kongresse und gibt wissenschaftliche Fachzeitschriften heraus. Darüber hinaus setzt sich die DOG für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Augenheilkunde ein, indem sie zum Beispiel Stipendien vor allem für junge Forscher vergibt. Gegründet im Jahr 1857 in Heidelberg ist die DOG die älteste medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft der Welt.