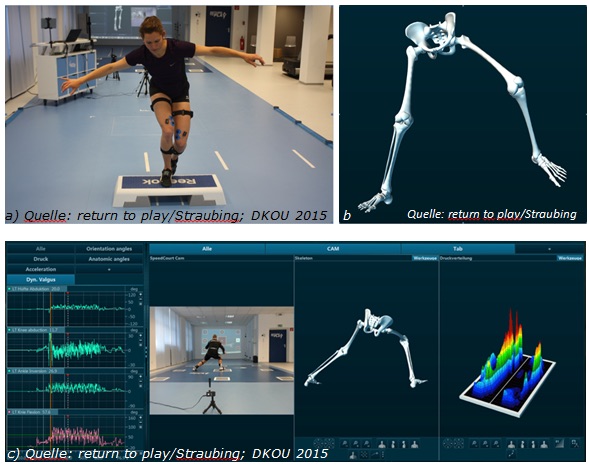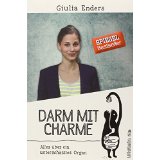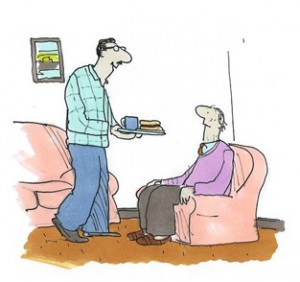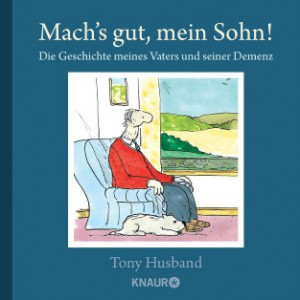Aus der Abwärtsspirale entkommen: Bewegung hilft gegen Depression
12. Europäischen Depressionstags am Donnerstag, 01. Oktober

Herbst-u-Depression: Mit den dunklen Monaten kehrt der Herbst- und Winterblues ein. Die saisonal abhängige Depression tritt allerdings bei nur etwa 10 Prozent der Betroffenen auf.
Unter dem Motto „Move against Depression“ wollen Forscher, Patienten und medizinische Fachkräfte am „12. Europäischen Depressionstag“ das Bewusstsein für die Volkskrankheit stärken. Auch der leitende Psychologe Dr. Andreas Schmidt der Dr. Becker Burg-Klinik hilft Betroffenen dabei, aus ihrer emotionalen Abwärtsspirale auszubrechen. Bewegung ist dabei eines der wichtigsten Mittel.
4,9 Millionen Menschen erkranken in Deutschland jährlich an einer behandlungsbedürftigen Depression, so die Zahlen der Deutschen Stiftung Depressionshilfe. Von 100 Menschen leiden etwa 20 mindestens einmal in ihrem Leben an einer Depression oder depressiven Verstimmung (Dysthymie). Sie verlieren ihren Antrieb, haben plötzlich kein Interesse mehr an Dingen, die ihnen früher Freude bereitet haben, sind häufig müde und bedrückt. Viele fühlen sich wie Gefangene in einem dunklen Loch, weil sie keinen Ausweg mehr aus der Antriebslosigkeit und der negativen Abwärtsspirale ihrer Gedanken und Gefühle finden.
„Die Depression wirkt wie ein permanenter innerer Stress und führt zu Anspannungssymptomen, die abgebaut werden müssen“, erklärt Dr. Andreas Schmidt, leitender Psychologe in der Dr. Becker Burg-Klinik. Jährlich kommen etwa 1.500 depressive Patienten in die psychosomatische Rehaklinik in Stadtlengsfeld, Thüringen. „Wir versuchen in der Rehabilitation ganzheitlich Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen und depressive Menschen zu aktivieren“, so Schmidt. Regelmäßige sportliche Betätigung helfe dabei, die krankheitstypischen Anspannungssymptome abzubauen und die Stresshormone zu ‚verbrennen’. Neben einer Verbesserung des Körpergefühls wirke körperliche Bewegung auch psychisch entspannend: Dunkle Gedanken werden vertrieben und die emotionale Abwärtsspirale wird unterbrochen. „Sport wirkt wie eine positive Selbstverstärkung: Ich schaffe etwas, ich komme wieder in Bewegung und finde Wege aus einer erlebten Starre heraus“, erklärt Dr. Schmidt.
Bewegung wirkt antidepressiv
Dass regelmäßige Bewegung eine stimmungsaufhellende Wirkung hat, konnte mittlerweile empirisch belegt werden. In einer Analyse von 39 Studien aus den vergangenen 23 Jahren, haben Forscher der Medical School Hamburg (MSH) die antidepressiven Effekte von Sport nachgewiesen. Zurückzuführen seien diese u. a. auf die erhöhte Ausschüttung von bestimmten Hormonen wie Serotonin und Noradrenalin, die beim Sport freigesetzt werden. Bei depressiven Menschen ist die Produktion von „Glücksbotenstoffen“ gehemmt, so dass sie einen niedrigeren Serotonin-Spiegel aufweisen.
In der Dr. Becker Burg-Klinik gehören sportliche Aktivitäten wie Nordic Walking, Gerätesport oder Aquagymnastik zum festen Bestandteil des Behandlungsprogramms depressiver Patienten. „Wir bieten vor allem Sportarten an, die auch Zuhause zum Einsatz kommen können. Schließlich ist es wichtig, dass Patienten den Sport auch langfristig in ihren Alltag integrieren können.“ Eine Hilfestellung dafür seien z. B. feste Wochenpläne, die nach jeder sportlichen Leistung eine kleine Belohnung vorsehen. „Sinnvoll für Menschen mit Depressionen sind neben Ausdauersporten auch Teamsportarten. Denn die fördern das soziale Miteinander und verhindern den sozialen Rückzug, der bei vielen depressiven Menschen einsetzt“, so Dr. Schmidt.
Mit schweren Depressionen zum Arzt

Dr. Andreas Schmidt: Dr. Andreas Schmidt, leitender Psychologe in der Dr. Becker Burg-Klinik, weiß wie wichtig Bewegung für depressive Menschen ist. In der Rehabilitation gehört die sportliche Betätigung fest zum Behandlungsplan.
Bei depressiven Verstimmungen leistet die regelmäßige körperliche Betätigung einen wichtigen Beitrag zum Spannungsabbau, zur Stabilisierung und Stimmungsverbesserung. Für Menschen mit mittelschweren bis schweren Depressionen reicht der Sport allein als Behandlungsmethode nicht aus, sondern wird ergänzend zu medikamentösen und psychotherapeutischen Verfahren eingesetzt. Dies kann auch bei leichteren depressiven Symptomen bereits sinnvoll sein.