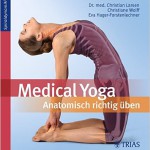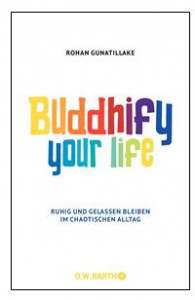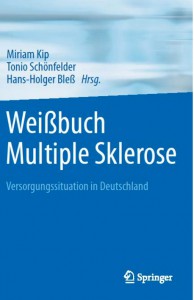Fortschritte in der Therapie der Multiplen Sklerose besser nutzen
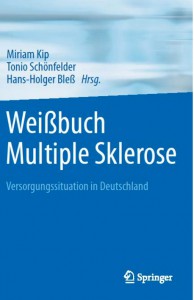 Weißbuch beschreibt Versorgungssituation bei Multipler Sklerose – Eine an der Krankheitsaktivität angepasste Behandlungsplanung ist noch unzureichend umgesetzt – Therapie der Symptome der Multiplen Sklerose weist große Defizite auf – Experten fordern strukturierte, besser vernetzte Versorgungskonzepte
Weißbuch beschreibt Versorgungssituation bei Multipler Sklerose – Eine an der Krankheitsaktivität angepasste Behandlungsplanung ist noch unzureichend umgesetzt – Therapie der Symptome der Multiplen Sklerose weist große Defizite auf – Experten fordern strukturierte, besser vernetzte Versorgungskonzepte
Berlin, 6. April 2016 (IGES Institut) – Dank der Fortschritte in der Behandlung der Multiplen Sklerose (MS) können immer mehr Betroffene ein weitgehend normales Leben führen. Dennoch lässt sich die Krankheit langfristig nicht stoppen. Zudem fehlen Therapien zur Versorgung der belastenden Symptome der MS. Nötig sind ferner mehr strukturierte Versorgungskonzepte. Das ist ein Fazit des Weißbuchs Multiple Sklerose, das IGES-Wissenschaftler zusammen mit medizinischen Experten veröffentlicht haben.
„Das Verständnis des Krankheitsbildes und die therapeutischen Möglichkeiten der Multiplen Sklerose haben sich deutlich gewandelt. Die wissenschaftliche Erfolge haben die MS zu einer beherrschbaren Krankheit gemacht, auch wenn sie weiterhin unheilbar ist. Strukturelle Defizite in der Versorgung dürfen diese Erfolge nicht ausbremsen“, sagt Prof. Judith Haas, Ärztliche Leiterin des Zentrums für Multiple Sklerose am Jüdischen Krankenhaus in Berlin und Vorsitzende der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e.V.
Früher Therapiebeginn und Behandlung nach Krankheitsaktivität wichtig
Bei MS kann eine frühe Therapie ausschlaggebend für den weiteren Verlauf sein. Patienten sollten nach einem ersten Schub zeitnah mit so genannten verlaufsmodifizierenden Medikamenten behandelt werden. Ziel ist es, Krankheitsaktivität zu verhindern (1). Experten sprechen von „no evidence of disease activity“, kurz NEDA. Anzeichen sind die Schubhäufigkeit, voranschreitende Behinderung, neuropsychologische Symptome wie die Fatigue sowie weitere Nervenschädigungen (2).
Wohnort entscheidet über Versorgung
Aber nur gut jeder zweite Patient mit Erstdiagnose erhält im gleichen Jahr auch eine verlaufsmodfizierende Therapie, wie Studien mit Daten aus 2009 zeigen (3). Dabei ist die Versorgung regional unterschiedlich: So suchten in Brandenburg, wo 4,4 Fachärzte auf 100.000 Einwohner kommen, nur 37 Prozent der Betroffenen innerhalb von sechs Wochen nach Erstdiagnose einen Facharzt für die Weiterbehandlung auf. In Hamburg waren dies mit 11 Fachärzten pro 100.000 Einwohner hingegen 64 Prozent. Zudem müssen in Regionen mit vielen ambulant tätigen Fachärzten weniger Patienten mit MS stationär behandelt werden, im Vergleich zu Regionen mit niedriger ambulanter Facharztdichte, wie Studien mit Krankenkassendaten zeigen (4).
Seit 2011 hat sich das therapeutische Spektrum durch fünf neue Präparate erweitert. „Der Verbrauch neuer MS-Medikamente hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen, was auf eine gute Verfügbarkeit der therapeutischen Optionen hindeutet“, sagt Hans-Holger Bleß, Leiter des Bereichs Versorgungsforschung am IGES Institut. „Studien weisen aber darauf hin, dass noch mehr Patienten von einer an die Krankheitsaktivität angepassten Therapie entsprechend den aktuellen Leitlinien profitieren können“, so Bleß.
Therapieabbrüche gefährden Behandlungserfolg
Barrieren stellen Therapieabbrüche dar. MS-Medikamente greifen in das Immunsystem ein und müssen oft lebenslang eingenommen werden. Studien zufolge nimmt nur gut jeder Dritte mit MS über einen Zeitraum von zwei Jahren verlaufsmodifizierende Medikamente kontinuierlich ein (5). Als Abbruchgründe nennen Patienten Nebenwirkungen und vermutete oder tatsächliche Unwirksamkeit der Therapie. Zudem führen sie die MS-typischen neuropsychologischen Symptome wie Depressionen oder die Fatigue an (6). Fatigue ist ein Gefühl starker geistiger und körperlicher Erschöpfung, das die Betroffenen sehr belastet. Sie stellt eines der häufigsten MS-Symptome dar.
„Neuropsychologische Symptome und Fatigue gelten immer mehr als Schlüssel im Umgang mit der Multiplen Sklerose, für die wir dringend Standards in Diagnostik und Therapie im Versorgungsalltag und mehr Behandlungsangebote benötigen“, sagt der Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Neurologen (BDN), Dr. Uwe Meier.
Defizite in der Behandlung der Symptome
Aber gerade in diesem Bereich konstatiert das Weißbuch Defizite. Es zeigt Auswertungen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), nach denen zwischen 2005 und 2006 bei jeweils rund 80 Prozent der MS-Patienten mit kognitiven Störungen wie Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen oder Fatigue keine Therapie erfolgte (7). Aktuellen Statistiken zufolge sind bundesweit knapp 300 Neuropsychologen ambulant tätig sind (8). Rein rechnerisch kämen somit rund 650 MS-Patienten auf einen ambulant tätigen Neuropsychologen.
Defizite bei der Spastik-Behandlung und Aufklärung über veränderte Sexualität
Verbesserungsbedarf besteht aus Sicht der Patienten zudem bei der Behandlung der für MS typischen Muskelversteifungen, medizinisch Spastiken. Therapie der Wahl ist die Physiotherapie, wenn nötig ergänzende Medikamente. Allerdings fehlen derzeit wirksame und langfristig einzunehmende Arzneimittel. DMSG-Daten zufolge erhält jeder dritte MS-Patient keine Therapie der Spastik. Ärzte fordern daher mehr physiotherapeutische Angebote, wie das Weißbuch darlegt.
86 Prozent der MS-Patienten fühlen sich zudem laut Umfragen unzureichend über die ebenfalls bei MS auftretenden Einschränkungen der Sexualität informiert. Jede zweite der betroffenen Frau wünscht sich dazu auch Paargespräche bei ihrem Arzt (9).
Die MS geht mit hohen Krankheitskosten einher
Die MS trifft vor allem Frauen in jungen Jahren, wenn persönliche Themen wie Familienplanung oder Karriere dominieren. Darüberhinaus ist die MS mit hohen Krankheitskosten verbunden. Insgesamt belaufen sich die direkten Behandlungskosten der MS durchschnittlich auf jährlich rund 22.000 Euro pro Patient. Die direkten und indirekten Kosten der mit der MS assoziierten Schübe betragen rund 3.000 Euro pro Schub. Mit fortschreitendem Krankheitsverlauf und zunehmender Behinderung spielen immer mehr Folgekosten etwa durch Arbeitsunfähigkeit eine Rolle (10, 11). Jeder zweite MS-Betroffene bezog 2010 eine Erwerbsminderungsrente (10, 4). Im Vergleich: In der Gesamtbevölkerung sind es durchschnittlich nur drei Prozent.
„Die Behandlung der MS erfordert aufgrund ihrer vielen Gesichter Ärzte und Heilberufler verschiedenster Disziplinen. Hier benötigen wir dringend besser vernetzte sowie patienten- und teilhabeorientiertere Versorgungsangebote“, sagt Meier.
Hintergrund Multiple Sklerose (MS)
MS ist mit bis zu 200.000 Betroffenen in Deutschland die häufigste chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems junger Menschen. Die Entzündungen schädigen die Nervenfasern, was zu schwerwiegenden neurologischen Ausfallerscheinungen und Behinderungen führen kann. MS manifestiert sich vor allem bei Frauen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Bei mehr als 85 Prozent der Patienten verläuft die MS in Schüben. MS ist unheilbar. Die genauen Ursachen sind noch immer nicht vollständig geklärt.
Das Weißbuch „Multiple Sklerose – Versorgungssituation in Deutschland“ wird von IGES-Experten herausgegeben und enthält Autorenbeiträge renommierter MS-Experten. Es ist im Springer-Verlag Berlin Heidelberg erschienen und ab Anfang Mai 2016 erhältlich. Das Buch entstand mit finanzieller Unterstützung des Unternehmens Novartis Pharma GmbH.
Literatur
(1) DGN (Hrsg.) (2014): Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose. Entwicklungsstufe: S2e. Stand: Januar 2012, Ergänzung August 2014.
(2) Stangel M, Penner IK, Kallmann BA, Lukas C & Kieseier BC (2015): Towards the implementation of ’no evi-dence of disease activity‘ in multiple sclerosis treatment: the multiple sclerosis decision model. Ther Adv Neurol Disord 8(1), 3-13.
(3) Höer A, Schiffhorst G, Zimmermann A, Fischaleck J, Gehrmann L, Ahrens H, Carl G, Sigel KO, Osowski U, Klein M & Bless HH (2014): Multiple sclerosis in Germany: data analysis of administrative prevalence and healthcare delivery in the statutory health system. BMC health services research 14, 381.
(4) IGES Institut (2014): Neurologische und psychiatrische Versorgung aus sektorenübergreifender Perspektive. Studie im Auftrag von Berufsverband Deutscher Nervenärzte e.V. (BVDN), Berufsverband Deutscher Neurologen e.V. (BDN), Berufsverband Deutscher Psychiater e.V (BVDP), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) / Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI), Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V (DGN). Ergebnisbericht.
(5) Hansen K, Schussel K, Kieble M, Werning J, Schulz M, Friis R, Pohlau D, Schmitz N & Kugler J (2015): Adherence to Disease Modifying Drugs among Patients with Multiple Sclerosis in Germany: A Retrospective Cohort Study. PLoS One 10(7).
(6) Bischoff C, Schreiber H & Bergmann A (2012): Background information on multiple sclerosis patients stopping ongoing immunomodulatory therapy: a multicenter study in a community-based environment. Journal of Neurology & Neurophysiology 259(11).
(7) Flachenecker P, Stuke K, Elias W, Freidel M, Haas J, Pitschnau-Michel D, Schimrigk S, Zettl UK & Rieckmann P (2008): Multiple sclerosis registry in Germany: results of the extension phase 2005/2006. Deutsches Ärzteblatt 105(7), 113-119.
(8) Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) e.V. (2015): Zertifizierte Neuropsychologen der GNP – Behandlerliste. 22.09.2015: 287 Einträge. 36001 Fulda: Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) e.V. http://www.gnp.de/_de/fs-Behandlerliste.php [Abruf am: 22.09.2015].
(9) Goecker D, Rösing D & Beier KM (2006): Der Einfluss neurologischer Erkrankungen auf Partnerschaft und Sexualität: Unter besonderer Berücksichtigung der Multiplen Sklerose und des Morbus Parkinson. Der Urologe 45(8), 992-998.
(10) Kobelt G, Berg J, Lindgren P, Elias WG, Flachenecker P, Freidel M, Konig N, Limmroth V & Straube E (2006): Costs and quality of life of multiple sclerosis in Germany. The European journal of health economics 7 Suppl 2, S34-44.
(11) Karampampa K, Gustavsson A, Miltenburger C & Eckert B (2012): Treatment experience, burden and unmet needs (TRIBUNE) in MS study: results from five European countries. Multiple sclerosis 18(2 Suppl), 7-15