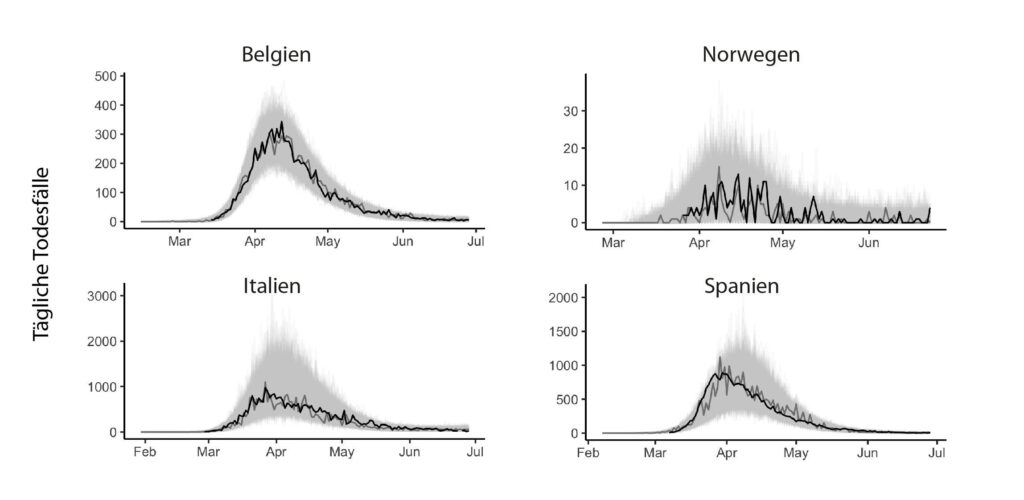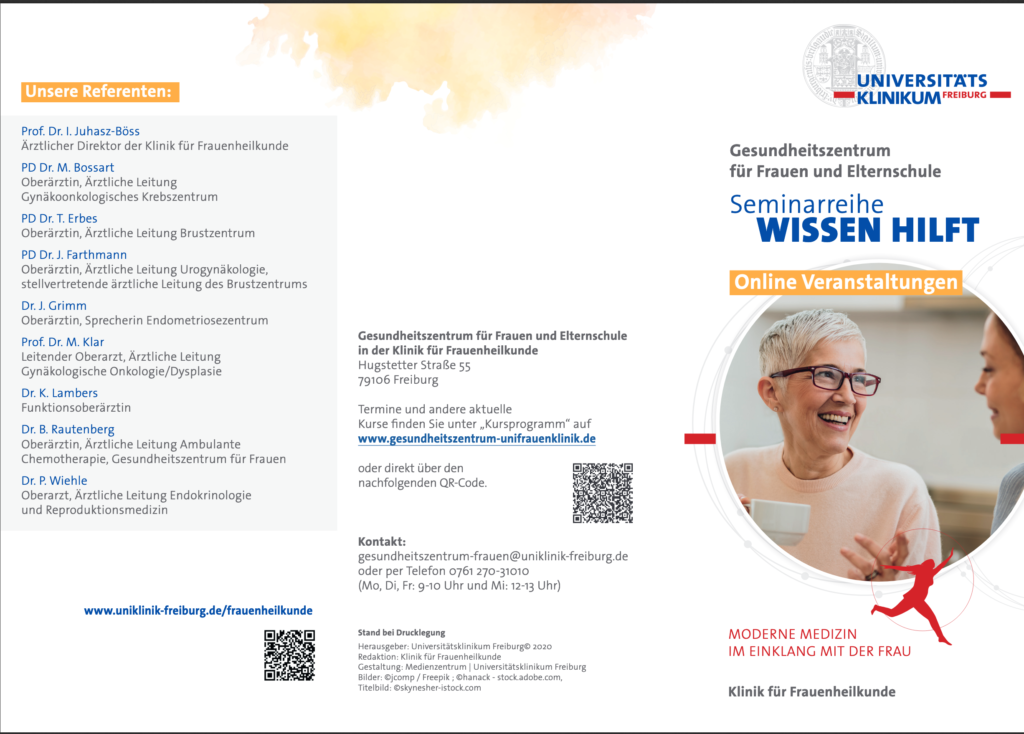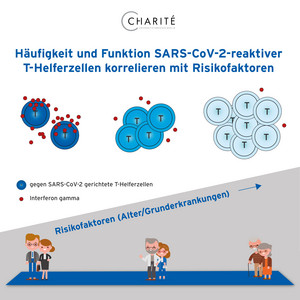Familien für Onlinebefragung gesucht / Digitales Symposium zu Herausforderungen von Kindern mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen

Schulunterricht daheim, weniger Kontakt zu Großeltern und eingeschränkte medizinische Versorgung: Die Corona-Pandemie hat das Leben von Familien teilweise stark verändert. In einer Studie untersucht das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Freiburg nun Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche mit und ohne chronische Erkrankungen und Behinderungen.
„Die Umstellungen waren für Familien sehr unterschiedlich, teils positiv und teils negativ. Mit der Umfrage möchten wir zu einem besseren Verständnis beitragen, welche Auswirkungen die Covid-19-Pandemie auf Familien hat“, sagt Studienleiter Dr. Thorsten Langer, Oberarzt in der Klinik für Neuropädiatrie und Muskelerkrankungen des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin. Die Ergebnisse der in Zusammenarbeit mit dem Verein Kindernetzwerk e.V. erstellten Studie sollen dazu beitragen, dass die Situation der Kinder und Familien bei zukünftigen Infektionsschutzmaßnahmen besser berücksichtigt werden kann.
Teilnehmende Familien gesucht
Für die Studie werden Familien gesucht, die insgesamt drei Online-Fragebögen im Zeitraum von September 2020 bis Herbst 2021 ausfüllen. Schwerpunkte sind die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben, der Einfluss der Pandemie auf das Familienleben sowie die Qualität der medizinischen Versorgung. Teilnehmen können Familien oder sorgeberechtigte Personen mit einem oder mehreren Kindern im Alter zwischen 1 und 18 Jahren. Die Onlinebefragung dauert jeweils 15 Minuten.
Hier geht es zur Umfrage: is.gd/covid19umfrage
Digitales Fachsymposium: Chronisch kranke Kinder im neuen Pandemie-Schulalltag
Darüber hinaus stellt ein digitales Fachsymposium die Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen oder Entwicklungsstörungen während der Corona-Pandemie in den Mittelpunkt. Am Mittwoch, 30. September 2020 von 16 Uhr bis 18 Uhr lädt das Sozialpädiatrische Zentrum des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Freiburg Fachpersonen aus den Bereichen Schule, Medizin, Psychologie, Integration und Frühförderung sowie Betroffene und Interessierte zu einem digitalen Fachsymposium ein. In Vorträgen und einer Podiumsdiskussion beleuchten Expert*innen und Betroffene unterschiedliche Perspektiven und bieten Raum für Austausch.
Weitere Informationen gibt es hier: www.uniklinik-freiburg.de/paed-neuro
Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten: https://register.gotowebinar.com/register/2776987448497847051
Einen Flyer zum Ablauf der Studie und das Programm des digitalen Fachsymposiums finden Sie hier: www.uniklinik-freiburg.de/presse/pressemitteilungen/detailansicht/2126-auswirkungen-der-corona-pandemie-auf-kinder.html