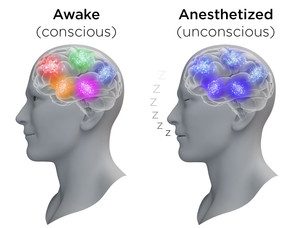Der DGG-Förderpreis für Interdisziplinäre Altersforschung geht an Anna Maria Meyer und Professorin M. Cristina Polidori
 Der mit 2.000 Euro dotierte Förderpreis für Interdisziplinäre Altersforschung geht in diesem Jahr an Anna Maria Meyer (Foto, links) und Professorin M. Cristina Polidori (rechts). Die Doktorandin und die Leiterin des Schwerpunktes Altersmedizin der Uniklinik Köln nahmen die Auszeichnung im Rahmen der Eröffnung des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) entgegen. Der Preis wurde bereits zum dritten Mal vergeben und zeichnet nun eine Forschungsarbeit der beiden Medizinerinnen aus, die sich mit dem Thema „Multidimensionale Prognoseberechnung bei älteren multimorbiden Patienten: Design und vorläufige Ergebnisse der MPI_InGAH-Studie“ beschäftigt. „Die Studie stach unter den eingereichten Arbeiten im Hinblick auf die wissenschaftliche Originalität, Interdisziplinarität, praktische Umsetzbarkeit und Bedeutung für die Zukunft deutlich heraus“, begründet Professor Gerald Kolb (Bildmitte), Vorsitzender des Preiskomitees, die Vergabe.
Der mit 2.000 Euro dotierte Förderpreis für Interdisziplinäre Altersforschung geht in diesem Jahr an Anna Maria Meyer (Foto, links) und Professorin M. Cristina Polidori (rechts). Die Doktorandin und die Leiterin des Schwerpunktes Altersmedizin der Uniklinik Köln nahmen die Auszeichnung im Rahmen der Eröffnung des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) entgegen. Der Preis wurde bereits zum dritten Mal vergeben und zeichnet nun eine Forschungsarbeit der beiden Medizinerinnen aus, die sich mit dem Thema „Multidimensionale Prognoseberechnung bei älteren multimorbiden Patienten: Design und vorläufige Ergebnisse der MPI_InGAH-Studie“ beschäftigt. „Die Studie stach unter den eingereichten Arbeiten im Hinblick auf die wissenschaftliche Originalität, Interdisziplinarität, praktische Umsetzbarkeit und Bedeutung für die Zukunft deutlich heraus“, begründet Professor Gerald Kolb (Bildmitte), Vorsitzender des Preiskomitees, die Vergabe.
In der MPI_InGAH-Studie haben Anna Maria Meyer und M. Christina Polidori den sogenannten Multidimensionalen Prognostischen Index (MPI) auf ältere Patienten in einer Akutklinik angewendet. Ein bewährtes Prognoseinstrument aus der Geriatrie. „Wenn ältere Patienten ins Krankenhaus kommen, überdeckt deren akutes Leiden häufig viele andere gesundheitliche oder psychosoziale Probleme“, sagt Anna Maria Meyer. Diese vermeintlichen Nebenschauplätze sind jedoch mitentscheidend über den weiteren Krankheits- und Genesungsverlauf.
Studie enthüllt unentdeckte Ressourcen bei älteren Patienten
Für die Studie hat die Doktorandin bei bislang 170 Patienten, allesamt 70 Jahre und älter, neben dem Gesundheitszustand unter anderem die Fähigkeiten im Alltag, den Ernährungszustand, die mentale Leistungsfähigkeit und das Dekubitus-Risiko mithilfe standardisierter Erhebungsbögen festgestellt. Aus diesen Daten hat sie den MPI errechnet – eine Kennzahl, die das Risiko der geriatrischen Patienten widerspiegelt, nach der Entlassung innerhalb von kurzer Zeit erneut ins Krankenhaus eingewiesen zu werden oder zu sterben. Aktuell werten die Wissenschaftlerinnen aus, wie sich einzelne dieser gesundheitlichen und psychosozialen Faktoren auf die Zeit auswirken, die ältere Patienten im Krankenhaus verbringen. Diese Daten sollen Ärzten bei der komplexen Entscheidung helfen, ob weitere therapeutische Maßnahmen im Krankenhaus dem jeweiligen Patienten eher helfen oder schaden. Ein positives Zwischenfazit zieht Meyer bereits: „Durch die gründliche und standardisierte Untersuchung konnten wir nicht nur Risiken, sondern auch Ressourcen der Patienten enthüllen, die sonst oft unentdeckt bleiben.“