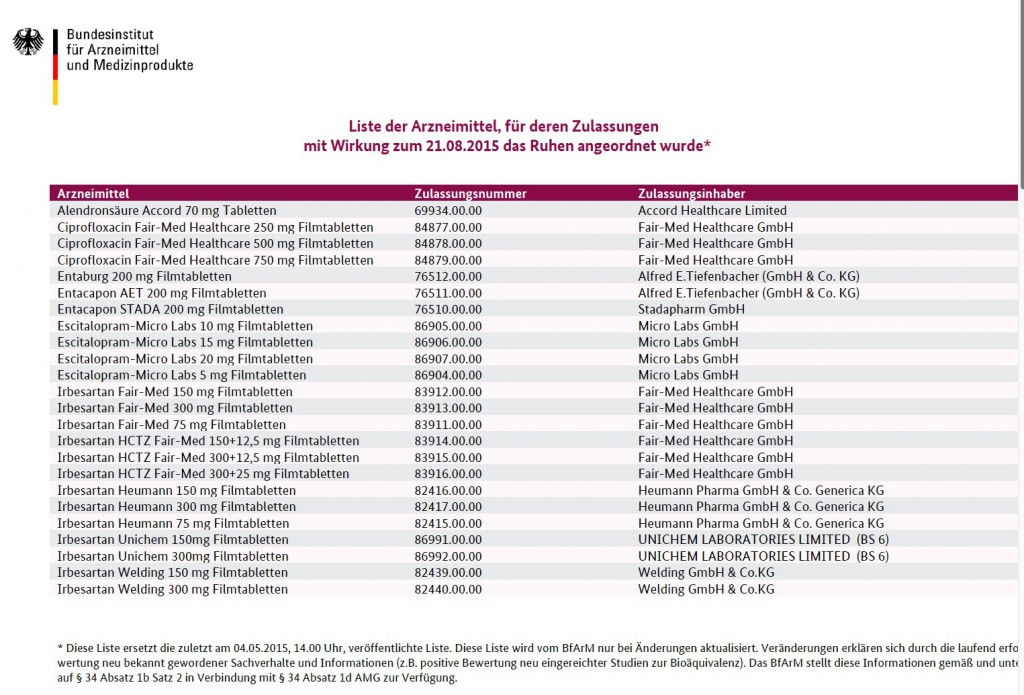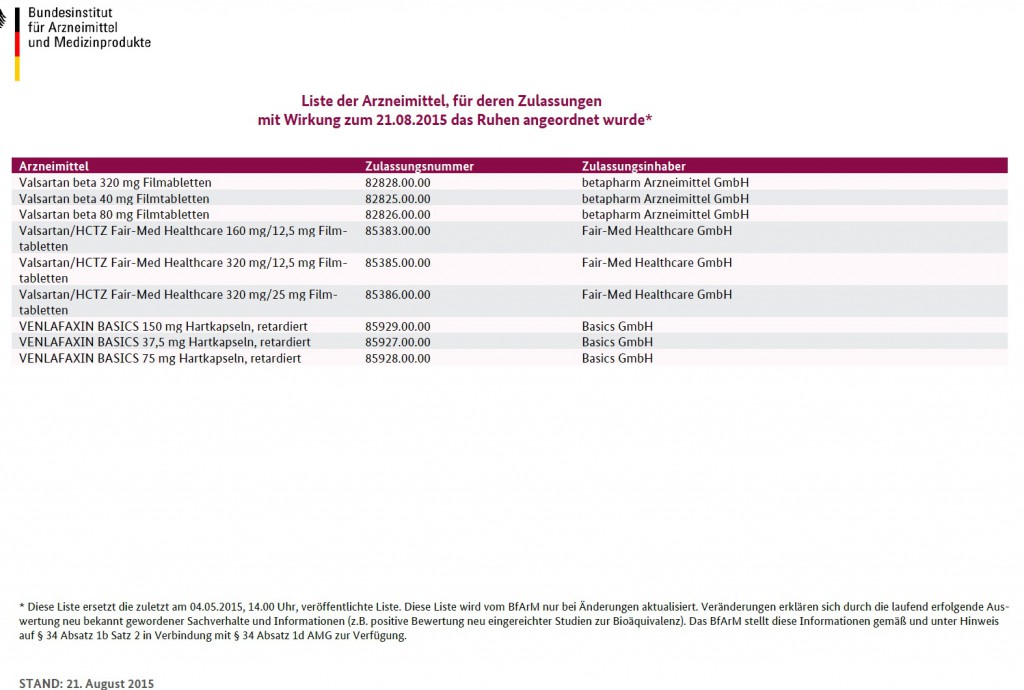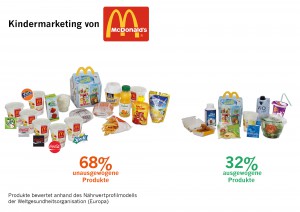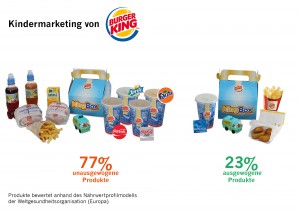Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Institut für Epidemiologie setzt EHEC-Studie fort
Die Folgestudie soll klären, wie es den Patienten und Patienentinnen fast 4 Jahre nach der EHEC-/HUS-Erkrankung geht. Auf diese Ergebnisse darf man gespannt sein.
2014 antwortet das Bundesgesundheitsministerium nach langer Zeit auf meine Anfrage. Darin hält das Ministerium an der Sprossen-Theorie von damals fest.
http://patientenkompetenz.info/324/ehec-ausloeser-immer-noch-ungeklaert/
Manche Krankenhäuser nehmen es mit der Hygiene nicht so genau. Diese Fotos zeigen das Krankenzimmer einer EHEC-Patienten 2011 auf der Privatstation eines Freiburger Krankenhaus. Das Zimmer war sehr klein. Bad gab es keines. Nur eine Toilette mit sehr kleinem Waschbecken, die allerdings mit angehängter Infusion nicht zu betreten war, weil die Tür so schmal war. Und das bei einer Durchfallerkrankung.
Ich werde versuchen, ob ich Bundesgesundheitsminister Gröhe beim World Health Summit 2015 in Berlin dazu befragen kann.
Das Robert-Koch-Institut informiert im RKI-Ratgeber für Ärzte über den
Infektionsweg
EHEC-Infektionen können auf vielfältige Art und Weise übertragen werden. Dabei handelt es sich stets um die unbeabsichtigte orale Aufnahme von Fäkalspuren, wie z.B. bei Kontakt zu Wiederkäuern oder beim Verzehr kontaminierter Lebensmittel. Darüber hinaus können EHEC durch kontaminiertes Wasser (z.B. beim Baden) übertragen werden. Auch Mensch-zu-Mensch-Übertragungen sind im Gegensatz zu anderen bakteriellen Gastroenteritis-Erregern ein bedeutender Übertragungsweg – wahrscheinlich begünstigt durch die sehr geringe Infektionsdosis von EHEC (< 100 Erreger für EHEC O157).
In Deutschland sind gemäß einer vom RKI durchgeführten Fall-Kontroll-Studie die Übertragungswege für sporadische EHEC-Erkrankungen altersabhängig. Demnach birgt bei Kindern unter drei Jahren – der Altersgruppe mit der höchsten Meldeinzidenz für EHEC- und HUS-Erkrankungen – der direkte Kontakt zu einem Wiederkäuer (Rind, Schaf oder Ziege) das höchste Erkrankungsrisiko. Weitere Risikofaktoren sind der Konsum von Rohmilch und das Vorkommen von Durchfall bei Familienmitgliedern. Bei Kindern über neun Jahren und Erwachsenen hingegen handelt es sich wahrscheinlich in erster Linie um eine lebensmittelbedingte Erkrankung, wobei insbesondere der Verzehr von Lammfleisch und von streichfähigen Rohwürsten (Zwiebelmettwurst, Streichmettwurst, Teewurst) mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko behaftet ist. Ungefähr die Hälfte aller EHEC-Isolate aus Lebensmitteln in Deutschland tragen die mit erhöhter Virulenz für den Menschen assoziierten Toxine Stx 2, Stx 2c und/oder Stx 2d. Unter diesen sind die häufigsten Serogruppen O113 und O91.
International wurden seit der Erstbeschreibung der Erreger im Jahr 1977 insbesondere durch Ausbruchsuntersuchungen eine Vielzahl von Vehikeln bzw. Übertragungswegen für menschliche EHEC-Erkrankungen nachgewiesen. In den USA beispielsweise waren über 50 % der Ausbrüche lebensmittelbedingt, und Rinderhackfleisch (z.B. in Hamburgern) war das am häufigsten identifizierte Lebensmittel. Aber auch andere Lebensmittel wie Salami, Mettwurst, Rohmilch, nicht pasteurisierter Apfelsaft und roh verzehrtes grünes Blattgemüse (z.B. Sprossen, Spinat) waren für Ausbrüche verantwortlich, wie epidemiologische und mikrobiologische Untersuchungen gezeigt haben.
In Deutschland ereigneten sich in den letzten Jahren mehrfach größere Häufungen von HUS-Erkrankungen, sämtlich verursacht durch eine sorbitol-fermentierende Variante von EHEC der Serogruppe O157, ohne dass bislang eine Infektionsursache ermittelt werden konnte. Hingegen sind hierzulande traditionelle EHEC-Ausbrüche (bei denen nicht überwiegend HUS-Erkrankungen beobachtetet werden) nach aktueller Datenlage selten. Zudem konnte die Infektionsquelle nur in den wenigsten Fällen aufgeklärt werden.