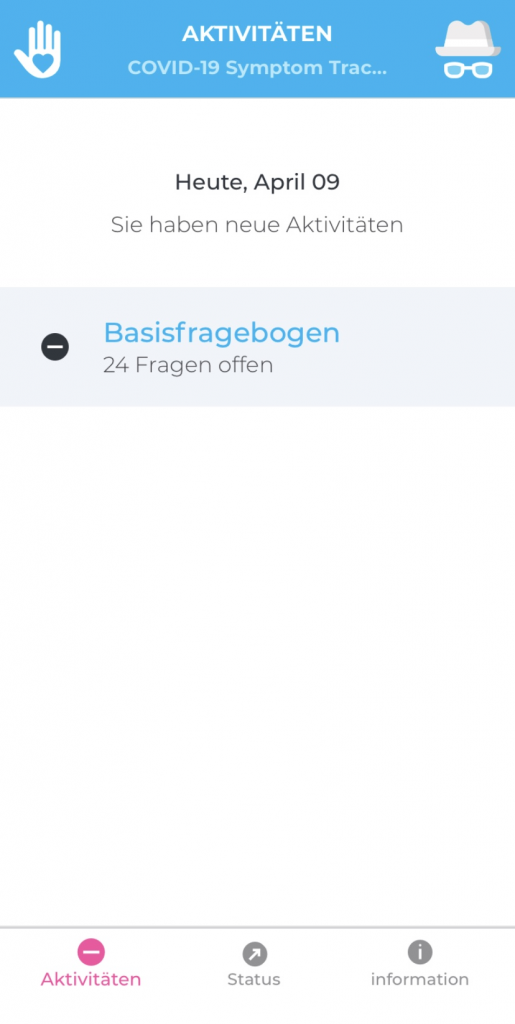Eine Stellungnahme der Präsidenten der außeruniversitären Forschungsorganisationen auf Basis von mathematischen Analysen der Datenlage

Diese Illustration, die in den Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) erstellt wurde, zeigt die
ultrastrukturelle Morphologie, die Koronaviren aufweisen.
Angesichts der großen öffentlichen Bedeutung einer objektiven Faktenlage zum Infektionsgeschehen haben sich unsere Forschungsorganisationen – Fraunhofer- Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Max-Planck- Gesellschaft – entschlossen, gemeinsam zur Datenlage Stellung zu nehmen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Organisationen, die sich mit der mathematischen Analyse der Ausbreitung der COVID-19-Erkrankungen und der Vorhersage der weiteren Entwicklung beschäftigen, haben ihre Ergebnisse zusammengetragen, eine gemeinsame Analyse der Situation verfasst und mögliche Bewältigungsstrategien aus Sicht der Modellierung vorgelegt. Detailliertere Informationen sind in der gemeinsamen Stellungnahme der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Anhang zu diesem Dokument zu finden, die wichtigsten Aussagen sind im Folgenden knapp zusammengefasst:
- Unterschiedliche und voneinander unabhängige Modelle verschiedener Gruppen zur Ausbreitung von SARS-CoV-2 kommen zu konsistenten Ergebnissen. Die Reproduktionszahl R lag seit Ende März leicht unter 1.
- Der klare Rückgang der Neuinfektionen N, den wir derzeit beobachten, ist der gemeinsame Effekt aller im März eingeführten Maßnahmen und der Verhaltensanpassungen der Bevölkerung.
- Die Situation ist nicht stabil, selbst eine nur kleine Erhöhung der Reproduktionszahl würde uns zurück in eine Phase des exponentiellen Wachstums führen. Daher muss die Reproduktionszahl bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs unter 1 gehalten werden. Der am 28. April 2020 vom RKI berichtete neue R-Wert nahe 1 verdeutlicht, dass in dieser Phase weiterhin konsequente Kontakteinschränkungen erforderlich sind.
- Der Wert von R in Antwort auf eine veränderte Maßnahme kann erst mit einer Verzögerung von zwei bis drei Wochen geschätzt werden.
- Das Erreichen einer „Herdenimmunität“ würde nach den bisher vorliegenden Daten einen Zeitraum von einigen Jahren erfordern, wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet werden soll. Einschränkende Maßnahmen müssten bei einer solchen Strategie über den gesamten Zeitraum aufrechterhalten werden.
- Aus Sicht der Modellierung erscheint folgende zweiphasige Strategie als sinnvoll: In der ersten Phase werden die Neuinfektionen weiter reduziert, bis eine effektive Kontaktverfolgung möglich ist. In der zweiten Phase schließt sich eine adaptive Strategie auf der Basis niedriger Zahlen von Neuinfektionen an.
Dazu sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Etablierung bzw. Weiterführung hygienischer Maßnahmen
- Ausbau von Testing- und Tracing-Kapazitäten
- Adaptive Steuerung von flankierenden kontakteinschränkenden
- Maßnahmen.
Bei politischen Entscheidungen über das weitere Vorgehen sind natürlich weitere Faktoren in Betracht zu ziehen, wie psychologische und weitere gesundheitliche Belastungen der Bevölkerung, die wirtschaftliche Entwicklung und internationale Vernetzung, um nur einige zu nennen. Die oben skizzierten und in der ausführlichen Stellungnahme der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler detaillierter dargestellten Zusammenhänge gelten aber unabhängig von solchen Faktoren, sodass alle Entscheidungen vor diesem Hintergrund getroffen werden müssen. Neue Gegebenheiten, wie die Verfügbarkeit eines Medikaments oder einer Vakzine, effizienteres Contact Tracing durch eine App, flächendeckendes Testen, spezifische Antikörper-Tests oder anderes würden in einem adaptiven Szenario die Nachsteuerung kontakteinschränkender Maßnahmen erlauben.
Die einschlägigen Forschungseinrichtungen und Expertinnen und Experten der beteiligten Organisationen haben ihre Aktivitäten früh der Untersuchung des Coronavirus aus verschiedenen Fachperspektiven gewidmet und insbesondere die Autorinnen und Autoren der vorliegenden Stellungnahme werden selbstverständlich weiter an der Modellierung und deren Datengrundlage arbeiten, um die Vorhersage der Ausbreitung zu verbessern und die Entwicklung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen.