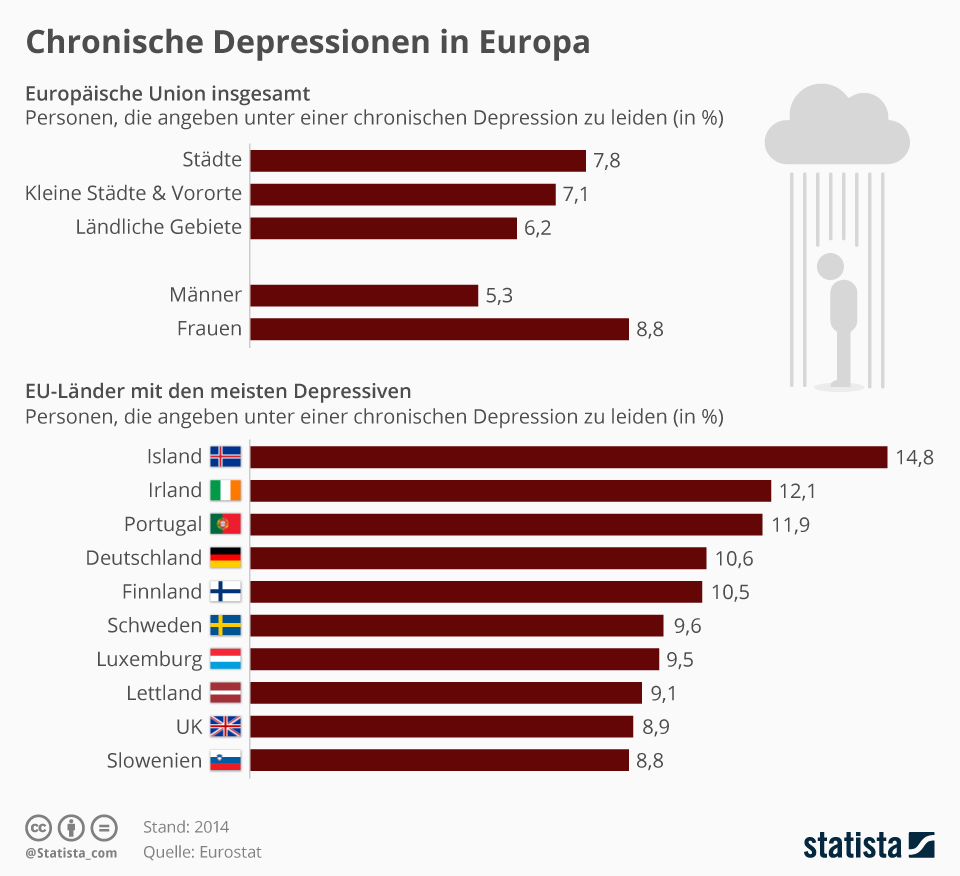Die ist eine Stellungnahme der Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG).
Altersmedizin: „Die Position der Geriatrie auf den
Intensivstationen muss gestärkt werden!“
Der demografische Wandel macht es zwingend notwendig, dass verstärkt
Altersmediziner in die Arbeit auf Intensivstationen eingebunden werden. Die Deutsche
Gesellschaft für Geriatrie (DGG) sieht akuten Handlungsbedarf und ruft dazu auf, die
internistische Intensivmedizin in Deutschland jetzt zu stärken und weiterzuentwickeln.
Mehr als 20 Prozent der Menschen auf einer internistischen Intensivstation sind 80 Jahre
alt und älter. Es sind klassisch geriatrische, multimorbide Patienten. Sie haben nicht nur
ein internistisches Grundproblem, sondern eingeschränkte Mobilität, Verlust der
Autonomie – möglicherweise sind es Patienten am Lebensende. „Dies ist eine spezielle
Herausforderung, zu der sich die Geriatrie als Fachgesellschaft ganz klar bekennen
muss“, sagt Professor Hans Jürgen Heppner, President-elect der DGG. „Wir sind
Internisten und Geriater und wir wollen bei der akuten Diskussion um die
intensivmedizinische Versorgung von kranken geriatrischen Patienten mitreden und
mitarbeiten!“ Heppner fordert, nicht nur die internistische Intensivmedizin sondern vor
allem die geriatrischen Besonderheiten in der Intensivmedizin nicht aus den Augen zu
verlieren: „Die Position der Geriatrie auf den Intensivstationen muss gestärkt werden!“.
Im Interview erklärt der Chefarzt der Geriatrie im Helios Klinikum Schwelm und
Lehrstuhlinhaber an der Universität Witten/Herdecke, vor welchen Herausforderungen
die Geriatrie und internistische Intensivmedizin nun stehen.
Herr Professor Heppner, die Internisten sorgen sich um den Verlust der
Leitungsfunktionen auf Intensivstationen. Jetzt fordern Sie hier auch die Position des
Geriaters zu stärken. Ist das nicht ein bisschen vermessen?
Heppner: Auf keinen Fall. Es ist zwingend erforderlich, dass Geriater und Internisten den
Schulterschluss suchen. Das ist meine persönliche Erfahrung aus vielen Jahren in der Akutund
Intensivmedizin. Stichwort demografischer Wandel: Wenn auf den Intensivstationen bald
jeder vierte Patient mit internistischen Krankheiten 80 Jahre und älter sind, also oft multimorbide
und in den Kompetenzen stark eingeschränkt, dann müssen wir Geriater unser Wissen zu
Lebensqualität, Funktionalität und Selbstständigkeit dieser Menschen an die Internisten
weitergeben. Auch die Erwartungen älterer Menschen an die Therapieansätze und
Unterstützung sind andere – deswegen sind Geriater in der Intensivmedizin so wichtig.
Geriatrisches Wissen auf den Intensivstationen ist also unumgänglich?
Geriatrisches Wissen auf den Intensivstationen ist also unumgänglich?
So ist es. Aber wir wollen niemandem die Arbeit abnehmen oder Kompetenzen beschneiden.
Ich bin ein klassischer Unterstützer der internistischen Intensivmedizin. Deswegen: Innere
Medizin und Geriatrie müssen sich hier zusammentun, das ist unsere gemeinsame Domäne.
Deswegen unterstützen wir die internistische Intensivmedizin uneingeschränkt.
Nun sehen wir die Geriatrie im Aufwind. Es werden verstärkt geriatrische Kliniken
gegründet. Sehen Sie diese Entwicklung auch in der Intensivmedizin?
Hier beobachte ich eher das Gegenteil: Die Intensivmedizin steht oft auf der Kippe. Sie ist eben
sehr teuer, auch wenn die anteilige Bettenzahl gering ist. Man will vielerorts weg von kleinen
Intensiveinheiten, hin zu größeren Zusammenschlüssen. Da mögen auch politische
Entscheidungen eine Rolle spielen, um Einfluss auf die Krankenhauslandschaft zu nehmen.
Aber müssten die Kliniken nicht gerade wegen des demografischen Wandels ihre
Bettenplätze in der Intensivmedizin aufstocken, um auf mehr geriatrische Patienten
vorbereitet zu sein?
Genau das wäre wichtig. Schon jetzt ist in der Notaufnahme jeder vierte Patient 80 Jahre oder
älter. 35 Prozent der Patienten sind über 70 Jahre. Bei denen erreichen wir beispielsweise
durch moderne, nichtinvasive Beatmungsmethoden große Behandlungserfolge, die zusätzliche
Komplikationen bei multimorbiden Patienten vermeiden. Diese Methoden gab es so vor zehn
Jahren noch nicht in dieser Form. Aber entsprechend ist dadurch aktuell die Zahl der
Beatmungstage und der Bedarf an entsprechenden Betten stark gestiegen. Darauf müssen wir
reagieren! Und das zeigt auch wieder, wie wichtig geriatrisches Knowhow in der Intensivmedizin
ist.
Sie sind selbst Internist, Geriater, aktiver Notarzt und Intensivmediziner. Das klingt nach
einer langen Ausbildung. Welche Qualifikationen sind notwendig, um als Geriater in der
internistischen Intensivmedizin zu arbeiten?
Die Basis ist eine medizinische Grundausbildung zum Internisten über mindestens fünf Jahre.
Dem folgt eine zweijährige Zusatzweiterbildung internistische Intensivmedizin. Anschließend
sind noch 18 Monate geriatrische Weiterbildung notwendig. Um als leitender Arzt eine
Intensivstation führen zu können, braucht man neben den Zusatzausbildungen der speziellen
oder allgemeinen Intensivmedizin auch noch viele Jahre Führungserfahrung. Die
Zusatzausbildung internistische Intensivmedizin ist nicht nur wegen der medizinischen Qualität
notwendig, sondern auch, um die Leistungen der Intensivstationen abrechnen zu können.
Damit steht der internistischen Führung einer Intensivstation doch nichts im Wege,
oder?
Leider schon. Denn im Gegensatz zu den Anästhesisten haben immer weniger Internisten den
skizzierten Ausbildungsweg durchlaufen. Es fehlen die Zusatzweiterbildungen. Das Problem ist
nun, dass der Anästhesist einen ganz anderen Ausbildungsschwerpunkt hat. Nur bis er sich
neben seiner täglichen Routine die wichtigen internistisch-geriatrischen Fragestellungen
einverleibt hat, vergeht viel Zeit. An der Stelle sehen wir in den Kliniken ganz deutlich, dass es
eben zu wenige geriatrische Intensivmediziner gibt.
Warum ist das so? Ist das kein attraktives und spannendes Arbeitsumfeld?
Natürlich ist es spannend – hochinteressant sogar. Und vor allem als Geriater kann ich
entscheidend in den Behandlungsverlauf eingreifen. Aber die Ausbildung ist eine echte
Herausforderung, das zusätzliche Lernen ist aufwändig, es geht zudem sehr viel um technische
Fragen. Am Ende winkt der Schichtdienst, der bringt manchen an die Grenzen der
Belastbarkeit. Auch für die Krankenhausträger entstehen zusätzliche Ausbildungskosten.
Weil sie also fehlen, warum können Geriater und Internisten dann nicht doch besser den
Anästhesisten in der Leitung konsiliarisch unterstützen?
Formal geht das schon. Aber der Aufwand dafür wäre enorm. Nicht nur für den Anästhesisten,
der sich neben seiner täglichen Arbeit zusätzlich mit unserm internistisch-geriatrisches
Knowhow beschäftigen muss. Auch für mich als Geriater und Internist wird der Zeitaufwand
größer. Denn in der Beobachtung des Patienten brauchen wir eine gewisse
Behandlungskontinuität. Ich muss sehen, wie sich der Patient entwickelt. Das ist oft eine Frage
von Stunden. Und wenn ich dann als Zuarbeiter so oft vor Ort bin, dann kann ich die Arbeit auch
direkt selbst machen. Das vereinfacht alle Prozesse und belastet die Anästhesisten nicht
zusätzlich. Deswegen ist es auf den Stationen von vorn herein wichtig, dass Internisten und
Geriater eng zusammenarbeiten. Das hat sich auch in der Vergangenheit bewährt.
Wie lässt sich dieser Konflikt also lösen? Woran arbeitet die DGG?
Wir wissen genau, wie die Behandlung älterer Patienten in der Intensivmedizin am besten
umzusetzen ist. Unsere zentralen Forderungen zur Zusammenarbeit mit Internisten haben wir
nun in einem gemeinsamen Aufruf aller internistischen Fachgesellschaften und des
Bundesverbandes Deutscher Internisten formuliert. Zusätzlich werden wir unsere Forderungen
mit wissenschaftlichen Argumenten untermauern. Dazu erarbeiten wir aktuell mit der Deutschen
Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) ein Positionspapier
zum geriatrischen Intensivpatienten, das voraussichtlich Ende des Jahres veröffentlicht wird.
Und wie kann die Situation für geriatrische Patienten auf der Intensivstation langfristig
verbessert werden?
Wir fordern, dass grundsätzliches Wissen über geriatrische Patienten in die Intensivmedizin
hineingehört. Moderne Intensivmedizin ohne das Wissen über den alten Menschen ist schlicht
nicht mehr möglich. Dazu brauchen wir motivierte Mediziner, die sich ihr Wissen über die
Schiene Innere Medizin und Akutmedizin sowie Zusatzweiterbildung Geriatrie aneignen und
dadurch noch bessere Arbeit auf den Intensivstationen leisten können. Noch ist dort nicht im
breiten Bewusstsein angekommen, wie wichtig das geriatrische Wissen ist. Denn: Beim alten
Menschen ist alles anders! Röntgenbilder, die Anatomie, physiologische Eigenschaften – alles
muss neu interpretiert werden. Wichtig ist, dass wir JETZT reagieren, denn die in den
kommenden Jahren werden noch deutlich mehr ältere Patienten in die Kliniken kommen.
Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG)
Die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG) ist die wissenschaftliche
Fachgesellschaft der Ärzte, die sich auf die Medizin der späten Lebensphase
spezialisiert haben. Wichtige Schwerpunkte ihrer Arbeit sind neben vielen anderen
Bewegungseinschränkungen und Stürze, Demenz, Inkontinenz, Depressionen und
Ernährungsfragen im Alter. Häufig befassen Geriater sich auch mit Fragen der
Arzneimitteltherapie von alten Menschen und den Wechselwirkungen, die verschiedene
Medikamente haben. Bei der Versorgung geht es darum, den alten Menschen
ganzheitlich zu betreuen und ihm dabei zu helfen, so lange wie möglich selbstständig
und selbstbestimmt zu leben. Die DGG wurde 1985 gegründet und hat heute rund 1700
Mitglieder.
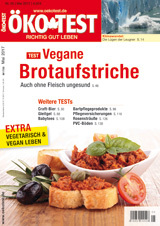 Die nachgewiesenen Mineralölbestandteile können sich im Körper anreichern und führten im Tierversuch zu Schädigungen der Leber und Lymphknoten. Sie stammen möglicherweise aus behandelten Jutesäcken, in denen Kakaobohnen transportiert werden. Unter den Mineralölbestandteilen sind in sechs Schokoladen auch aromatische Kohlenwasserstoffe (MOAH). Sie können Anteile enthalten, die in kleinsten Mengen Krebs erregen.
Die nachgewiesenen Mineralölbestandteile können sich im Körper anreichern und führten im Tierversuch zu Schädigungen der Leber und Lymphknoten. Sie stammen möglicherweise aus behandelten Jutesäcken, in denen Kakaobohnen transportiert werden. Unter den Mineralölbestandteilen sind in sechs Schokoladen auch aromatische Kohlenwasserstoffe (MOAH). Sie können Anteile enthalten, die in kleinsten Mengen Krebs erregen.