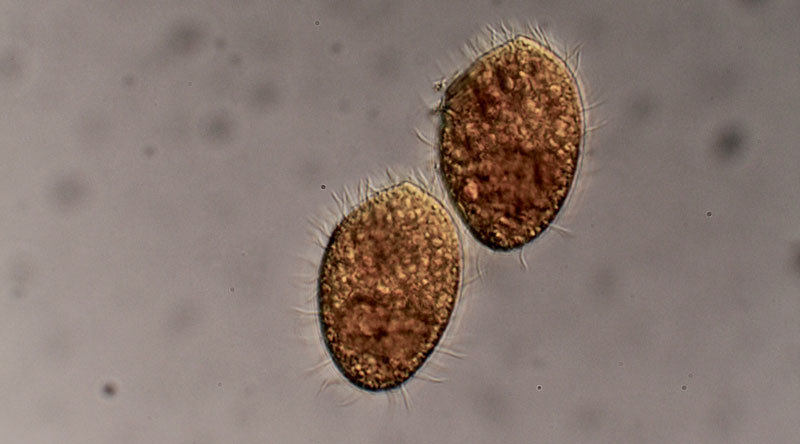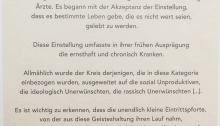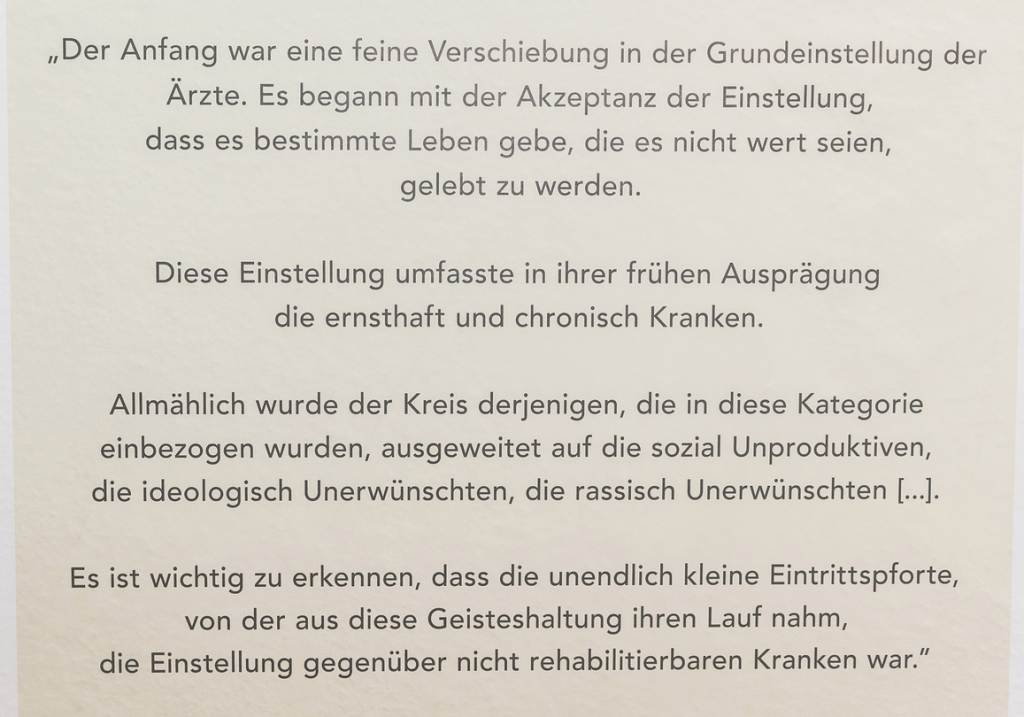Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die Familienmitglieder pflegen
Start des Beratungsprojekts „Pausentaste – Wer anderen hilft, braucht manchmal selber Hilfe“ |
||
| Nicht nur Erwachsene kümmern sich um chronisch kranke, behinderte oder pflegebedürftige Angehörige. Nach einer Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) versorgen und pflegen rund 230.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland regelmäßig beispielsweise ihre Eltern oder Geschwister.
Um diese jungen Menschen zu unterstützen, hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) das Projekt „Pausentaste – Wer anderen hilft, braucht manchmal selber Hilfe. Das Angebot für Kinder und Jugendliche, die sich um ihre Familie kümmern“ ins Leben gerufen. Bundesfamilienministerin Dr. Katarina Barley betont: „Mit der ‚Pausentaste‘ starten wir in Kooperation mit der ‚Nummer gegen Kummer‘ ein anonymes Hotline- und E-Mail-Angebot. Auch ist die Website www.pausentaste.de jetzt online gestellt. Damit geht das erste Unterstützungsangebot auf Bundesebene für pflegende Kinder und Jugendliche ans Netz, das Fragen rund um die Pflege beantwortet und Hilfestellung in belastenden Situationen bietet. Denn: Wer anderen hilft, braucht eben manchmal auch selber Hilfe“, so die Bundesministerin. Junge Leute mit Pflegeverantwortung verrichten häufig wie selbstverständlich den Haushalt der Familie und kümmern sich um jüngere Geschwister. Sie leisten auch Pflegetätigkeiten wie z.B. Mobilisation und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme. Oft sind diese Kinder und Jugendlichen körperlich überanstrengt und haben weniger Freizeit als ihre Freundinnen und Freunde. Nicht selten verschlechtern sich ihre Leistungen in der Schule. Mit ihren Sorgen und Ängsten stehen sie häufig ganz allein da. Bundesfamilienministerin Dr. Katarina Barley dazu: „Über www.pausentaste.de wollen wir in erster Linie die Kinder und Jugendlichen erreichen. Wir wollen aber auch Lehrerinnen und Lehrer, ambulante Pflegedienste, Sozialdienste an Schulen und Kliniken sowie Jugendorganisationen und die Öffentlichkeit für die Situation sensibilisieren.“ Online sind Erfahrungsberichte und Interviews mit jungen Pflegenden, Videos und Hinweise auf Beratungsangebote vor Ort. Auch Informationen zu Erkrankungen und Leseempfehlungen werden zur Verfügung gestellt, alles optimiert für mobile Endgeräte. Darüber hinaus können Kinder und Jugendliche sich kostenlos – auch anonym – an die Hotline des Kinder- und Jugendtelefons der „Nummer gegen Kummer“ wenden – unter der kostenlosen Nummer 116 111 oder per E-Mail über www.nummergegenkummer.de. Hintergrundinformation: Nummer gegen Kummer e.V. ist ein Verein mit 109 Mitgliedern. Dies sind lokale Vereine, die einen Standort des Kinder- und Jugendtelefons und/oder einen Standort des Elterntelefons unterhalten. Diese Standorte sind in ganz Deutschland verteilt. Die lokalen Träger der Beratungstelefone sind überwiegend örtliche Verbände des Deutschen Kinderschutzbundes, Vereine, die extra zu diesem Zweck gegründet wurden oder weitere örtliche Träger der Freien Jugendhilfe wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie oder die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz. Dieses Netzwerk stellt das deutschlandweit größte kostenfreie, telefonische Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern dar. Die Hotline ist erreichbar von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr. An Samstagen gibt es zudem eine „Peer-to-Peer“–Beratung durch speziell ausgebildete Beraterinnen und Berater im Alter von 16 bis 21 Jahren. Die ebenfalls anonyme E-Mail-Beratung über www.nummergegenkummer.de ist rund um die Uhr erreichbar (weitere Informationen unter www.nummergegenkummer.de). |