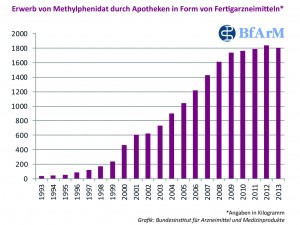Pressemitteilung
Deutsche Diabetes Gesellschaft kritisiert Entscheidung des G-BA zu Canagliflozin
Berlin, 26. September 2014 – Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), das Diabetesmedikament Canagliflozin nicht von den Krankenkassen erstatten zu lassen, scharf kritisiert. Der G-BA verhindere durch seine Entscheidung die Einführung einer neuen Gruppe von effektiven und sicheren Wirkstoffen, die für die Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes benötigt werden, erklärte DDG Präsident Privatdozent Dr. med. Erhard Siegel. Auf Grund des Beschlusses wird der Vertrieb in Deutschland nun eingestellt.
Canagliflozin ist nach Dapagliflozin der zweite Wirkstoff aus der Gruppe der SGLT-2-Hemmer („Gliflozine“), die den Blutzucker senken, indem sie die Ausscheidung von Zucker über die Nieren fördern. Im Juni vergangenen Jahres hatte der G-BA Dapagliflozin einen therapeutischen Zusatznutzen abgesprochen. Nun wurde auch die Verordnung von Canagliflozin auf Kassenrezept verhindert.
„SGLT-2-Hemmer sind eine wertvolle Bereicherung der therapeutischen Möglichkeiten, da sich der Wirkungsmechanismus von allen bisher verfügbaren Mitteln unterscheidet“, stellt Professor Dr. med. Dirk Müller-Wieland fest, Mediensprecher der DDG. Das Medikament komme deshalb insbesondere für Patienten infrage, die mit anderen Mitteln keine ausreichende Blutzuckersenkung erzielen und den Einsatz von Insulin vermeiden wollen. Bei diesen Patienten könne mit SGLT-2-Hemmern eine deutliche Senkung des Blutzuckerlangzeitwertes HbA1c erreicht werden. „Der G-BA versperrt mit seiner Entscheidung nun Kassenpatienten in Deutschland zum zweiten Mal diese Therapieoption“, kritisiert Siegel. „Canagliflozin ist für uns ein wertvolles Mittel in der Zusatztherapie für Patienten, das entsprechend den Zulassungsbedingungen allen Patienten zur Verfügung stehen sollte.“
SGLT-2-Hemmer senken nicht nur den Blutzucker, es kommt auch zu einem leichten Rückgang von Blutdruck und Körpergewicht. „Bei übergewichtigen Menschen mit Typ-2-Diabetes, die häufig einen zu hohen Blutdruck haben, ist dies ein günstiger Nebeneffekt, der langfristig Herzkreislauferkrankungen vorbeugen könnte“, sagt Siegel. „Wir betrachten Canagliflozin deshalb als geeignetes Mittel zur Monotherapie, wenn Ernährungsumstellung und Bewegung allein den Blutzucker nicht ausreichend senken und eine Anwendung von Metformin aufgrund von Unverträglichkeit oder Gegenanzeigen nicht möglich ist.“ Die Monotherapie sei nun vom Markt genommen, der Vertrieb der Substanz wird in Deutschland eingestellt.
Der G-BA stützt sich in seiner Entscheidung auf ein Gutachten des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), das nach Ansicht der DDG schwere Mängel aufweist. So hatte das IQWiG eine zentrale Zulassungsstudie aus methodischen Gründen nicht berücksichtigt. Die Studie hatte Canagliflozin mit dem Sulfonylharnstoff Glimepirid als Zusatztherapie bei Patienten untersucht, die mit Metformin allein keine ausreichende Blutzuckersenkung erzielen. In der Studie war die Dosis von Glimepirid langsam gesteigert worden, während Canagliflozin gleich in der vollen Dosis gegeben wurde. Das IQWiG interpretierte dies als unfairen Vergleich.
Aus Sicht der DDG ist es jedoch gängige Praxis. „Bei Sulfonylharnstoffen ist eine langsame Titrierung der Dosis üblich, da es unter der Therapie schnell zu Unterzuckerungen kommen kann“, erläutert Müller-Wieland. Bei SGLT-2-Hemmern besteht die Gefahr nicht. Dass es in der Studie trotz der Titration unter Glimepirid etwa sieben Mal häufiger zu Unterzuckerungen (Hypoglykämie) kam, ist für die DDG Experten ein klares Argument für den Einsatz von Canagliflozin. „Wir würden bei einem Patienten mit erhöhtem Hypoglykämierisiko immer einen SGLT-2-Hemmer bevorzugen“, sagt Müller-Wieland. Bedauerlicherweise seien Fachverbände wie die DDG bei der Beurteilung von neuen Wirkstoffen nicht konsultiert worden. „Fehleinschätzungen wie bei Canagliflozin könnten in diesem Fall verhindert werden“, betont Müller-Wieland.
Die DDG befürchtet zudem, dass die vom G-BA getroffenen Entscheidungen zum Zusatznutzen neuer Medikamente in der Behandlung des Typ-2 Diabetes künftig die Entwicklung von Monopolstellungen einzelner Substanzen fördern könnten. „Daran kann dem G-BA nicht gelegen sein“, meint Siegel.
Beschluss des G-BA:
https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/105/
Stellungnahme der DDG zum IQWiG-Gutachten:
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/Stellungnahmen/DDG_Stellungnahme_Canaglifozin_final_30062014.pdf