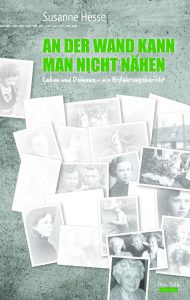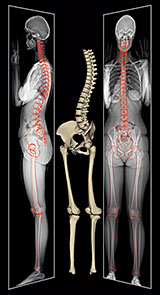Aktiv bleiben und Gesundheit dauerhaft stärken
 BDP-Bericht 2016 „Älter werden – gesund bleiben“ erschienen
BDP-Bericht 2016 „Älter werden – gesund bleiben“ erschienen
Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen plädiert für eine stärkere Einbindung der psychologischen Expertise in einer alternden Gesellschaft. Anlässlich der Präsentation des neuen BDP-Berichts 2016 „Älter werden und gesund bleiben“ erklärt BDP-Präsident Prof. Dr. Michael Krämer: „Erkenntnisse für das gesunde Altern lassen sich aus der Psychologie gewinnen. Wir zeigen auf, dass jeder im Alter noch viele Ressourcen hat und auch die Gesellschaft durch infrastrukturelle Maßnahmen und personelle Unterstützung einen Beitrag zu deren Nutzung und Erhaltung leisten muss. Wer aktiv ist und bleibt, ist auf dem guten Weg zur Gesundheit im Alter. Wer es noch nicht ist, dem kann Psychologie helfen, aktiv zu werden und seine Lebensqualität zu verbessern.“
Auf 96 Seiten erläutern namhafte Experten in dem Bericht ihre Einschätzungen und stellen dar, welchen Stellenwert die Psychologie in diesem Themenfeld hat und haben kann. Thematisiert werden u. a. die Handlungsfelder psychische und körperliche Aktivität, Mobilität, Ernährung, Arbeit und der Übergang zum Leben im Rentenalter, bürgerschaftliches Engagement als Gesundheitsfaktor, Strukturen der Gesundheitsversorgung, Konzepte bei demenziellen Erkrankungen, die Stärkung von pflegenden Angehörigen und Gestaltung einer würdevollen letzten Phase.
Hier können Sie konstelos den Bericht herunterladen: www.bdp-verband.de/aktuell/2016/bericht
Prof. Dr. Michael Krämer
Präsident des BDP
Warum Psychologen beim Alter mitreden sollen
Statement
Im gesellschaftlichen Kontext verändert sich aktuell die Wahrnehmung des Alterns. Im Unterschied zur früheren, an der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit junger Menschen orientierten Alternsauffassung, wird dem biologischen Lebensalter geringere Bedeutung beigemessen. Eine psychologische Sichtweise, die individuell unterschiedliches Gesundheitserleben in verschiedenen Lebensphasen berücksichtigt und positiv unterstützt tritt zu modernen Altersbildern und dem Erleben des Älterwerdens hinzu. Dazu gehört auch die Veränderung des Nichtbefassens mit dem Thema „Gesundheit“ in einer Lebensphase, in der keine körperlichen Einschränkungen erlebt werden, oder in einer anderen Phase die intensive Auseinandersetzung mit körperlichen Einschränkungen und Defiziten. Das Lebensalter ist dabei nicht mehr der einzig maßgebliche Faktor. Mittlerweile kann die Psychologie als Wissenschaft auf eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit dem Thema „Altern“ verweisen. Allerdings werden psychologische Einflussfaktoren auf das Alterserleben und die Entwicklung und Stabilisierung förderlicher Aktivitäten noch zu wenig berücksichtigt.
Vita
Prof. Michael Krämer wurde zum Bankkaufmann in Mainz und Frankfurt/Main ausgebildet und studierte Psychologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie Erziehungs- und Sozialwissenschaften an der Fern Universität Hagen mit anschließender Promotion am Fachbereich Psychologie der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/Main. Anschließend war er in einer internationalen Personal-und Unternehmensberatung tätig. Seit 1995 ist er Professor für Psychologie an der Fachhochschule Münster, 2011 bis 2013 Vizepräsident und ab 2013 Präsident des BDP.
Im Auftrag des BDP arbeitete er von 2003 bis 2005 in der gemeinsamen Planungskommission der Föderation der deutschen Psychologenverbände und ab 2006 in der Nationalen Anerkennungskommission für das Europäische Zertifikat in Psychologie der Vereinigung Europäischer Psychologenverbände EFPA (European Federation of Psychologists Associations) mit. Seit 2010 ist er Mitglied des Beirats der Psychologischen Hochschule Berlin.
Julia Scharnhorst
Vorstandsmitglied der Sektion Gesundheitspsychologie des BDP
Altern – und nicht nur an Defizite denken
Statement
Beim Thema „Älterwerden“ denken viele Menschen als Erstes an all das, was im Alter nachlässt und verloren geht: körperliche Beweglichkeit, die Sinneswahrnehmung, geistige Fähigkeiten und vieles mehr. Oftmals wird das Alter also mit Krankheit und Defiziten verbunden. Das führt dazu, dass sich viele Menschen mit dem Älterwerden selbst immer weniger zutrauen und gesellschaftlich oft an den Rand gedrängt werden, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Dieses Altersbild stimmt jedoch schon lange nicht mehr. Keine bisherige Generation älterer Menschen war besser qualifiziert oder leistungsfähiger als die jetzige. Damit spätere Lebensphasen bei gutem Wohlbefinden erlebt werden, ist es sinnvoll, schon früh mit einem gesunden Lebensstil zu beginnen.
Vita
Julia Scharnhorst, Jahrgang 1960, hat in Hamburg Psychologie und in Hannover Public Health studiert. Als Klinische Psychologin wirkte sie bei der Rehabilitation von Patienten mit Erkrankungen auf den Gebieten der Gastroenterologie, Onkologie, Stoffwechselerkrankungen, Kardiologie und Diabetes mit. Seit 1999 ist sie als Psychologische Psychotherapeutin approbiert. Von 2000 bis 2003 leitete sie in einer großen Hamburger Versicherung die Abteilung Gesundheitsmanagement. Danach gründete sie Health Professional Plus, um Unternehmen bei der Gesundheitsförderung und Prävention zu beraten. Von 2005 bis 2007 war sie Vizepräsidentin des BDP. Seit 2000 leitet Julia Scharnhorst den Fachbereich „Gesundheitspsychologie“ in der Sektion Gesundheits-, Umwelt- und Schriftpsychologie des BDP.
Prof. Dr. Dr. hc. mult. Ursula Lehr
Stellv. Vorsitzende der BAGSO/Bundesministerin a.D.
Gesundes Altern – eine Herausforderung für jeden Einzelnen und die Gesellschaft
Statement
Gesundheit ist keineswegs ein Gut, das uns in jungen Jahren gegeben wurde und das mit der Zeit mehr und mehr abnimmt, sondern Gesundheit muss jeden Tag neu erkämpft werden. Gesundheit will gepflegt werden. Vorsorgeuntersuchungen sind notwendig, um möglichst frühzeitig Fehlentwicklungen zu entdecken und zu bekämpfen. Prävention spart Krankheitskosten und erhöht die Lebensqualität! Die meisten „Alterskrankheiten“ sind alternde Krankheiten, gegen die man in jüngeren Jahren bereits hätte angehen können -wenn sie rechtzeitig diagnostiziert worden wären.
Aktivitäten im körperlichen Bereich, im kognitiven Bereich und im sozialen Bereich sind notwendig. Wir müssen „bewegt altern“, um „fit für 100″ zu sein. Wir müssen aber auch „lernend altern und Altern lernen“. Lebenslanges Lernen ist heutzutage geradezu zur Existenznotwendigkeit geworden. Und wir sollten um soziale Kontakte bemüht sein. Lebensqualität wird dort erlebt, wo der Mensch noch eine Aufgabe hat. Wer keine Aufgabe hat, gibt sich auf; Hobbys und Freizeitaktivitäten, soziale Kontakte bzw. bürgerschaftliches Engagement sind gefragt.
Aber auch die Gesellschaft, das Land, die Kommune, die Gemeinde, sind herausgefordert, zu einem gesunden, selbstbestimmten und sinnerfüllten Älterwerden der Bürgerinnen und Bürger beizutragen.
Vita
Jahrgang 1930, aus Frankfurt am Main, Studium der Psychologie und Philosophie an den Universitäten Frankfurt und Bonn; 1954 Promotion, 1968 Habilitation (Forschungen „Frau und Beruf); Lehrstuhl Universität Köln (1972-1975), Universität Bonn (1975-1986); 1986-1998 Lehrstuhl für Gerontologie Universität Heidelberg; seit 2001 Professur an der Europa-Universität in Yuste/Extramadura in Spanien. 1988-1991 Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, 1991-1994 Mitglied des Deutschen Bundestages; Ehrenpromotion der Universitäten Fribourg/Schweiz (1988) und Vechta (2009). Korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (seit 1994) und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (seit 1998). Großes Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschlands. Forschungen im Bereich der Entwicklungs- und Sozialpsychologie und der Gerontologie, ältere Arbeitnehmer, demografischer Wandel. 2004-2008 Präsidentin der Vereinigung der ehemaligen Mitglieder des Deutschen Bundestages unddes Europäischen Parlaments e.V. 2009-2015 Vorsitzende der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren Organisationen), seit 2015 stellvertretende Vorsitzende.