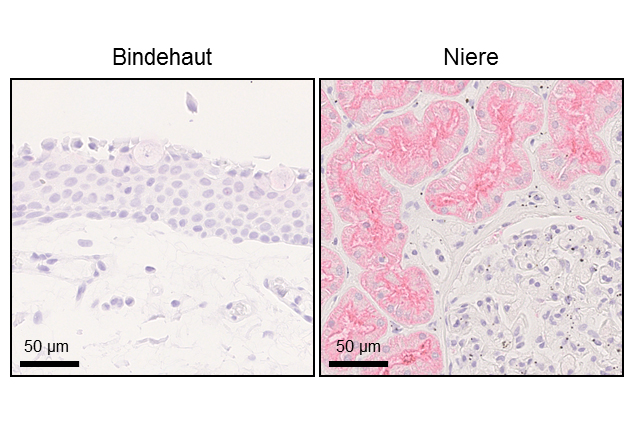VIRUS: erstes COVID-19-Register zur Nachverfolgung der globalen Erfahrung von Intensivstationen, um Trends bei der Versorgung schwerkranker Patienten aufzuzeigen
MOUNT PROSPECT, Illinois — Die Society of Critical Care Medicine (SCCM, Gesellschaft für Intensivmedizin) und Mayo Clinic haben sich zusammengetan, um das erste globale COVID-19-Register einzuführen, das Muster bei der Versorgung auf Intensivstationen und in Krankenhäusern in Echtzeit aufzeigt. Das von der SCCM-Abteilung Discovery gegründete Critical Care Research Network (Forschungsnetzwerk für Intensivpflege) wird eine Studie durchführen, die Allgemeine Studie für Virusinfektionen und Krankheiten der Atemwege (Viral Infection and Respiratory Illness Universal Study (VIRUS)), die Variationen in der Praxis aufzeigt und eine breite Datenbank für die Erforschung effektiver Behandlungen und Pflege darstellen wird.
Das Register, das täglich wächst, verfügt über ein Dashboard mit Daten von mehr als 3.400 Patienten aus 110 Gesundheitsversorgungsstandorten in acht Ländern. Das regelmäßig aktualisierte Dashboard verfolgt Daten zu Trends wie Dauer der mechanischen Beatmung, Dauer des Aufenthalts auf der Intensivstation, Details der Entlassung aus der Intensivstation und Art der medizinischen Betreuung, die Patienten bekommen, sowie demografische Daten der Patienten: Geschlecht, Alter und ethnische Zugehörigkeit.
„Die COVID-19-Pandemie hat Gesundheitsversorgungssysteme in aller Welt vor noch nie erlebte Herausforderungen gestellt, aber wir leben in einer immer stärker miteinander verbundenen Welt, und wir müssen zusammenarbeiten und aus unseren gegenseitigen Erfahrungen lernen, um zu versuchen, die Schwere der Auswirkungen zu verringern“, sagte Dr. Rahul Kashyap, M.B.B.S., M.B.A., ein Forscher bei Mayo Clinic und Prüfarzt des VIRUS COVID-19-Registers. „Die zeitnahe Verbreitung des in einer einzigen Datenbank versammelten Wissens ist bei Studien der vergleichbaren Wirksamkeit von großer Bedeutung. Das wird bahnbrechend sein.“
Die Open-Access-Beobachtungsstudie und das Register schließen anonymisierte klinische Daten von Kindern und Erwachsenen ein, die aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingewiesen wurden, wobei das REDCap-Datenerfassungssystem verwendet wird, eine sehr sichere Datenbank von Mayo Clinic. Standorte haben jederzeit Zugang zu ihren eigenen Daten und können dem Lenkungsausschuss von SCCM Discovery Begleitforschungsprojekte vorschlagen, bei denen die VIRUS-Daten zur Forschung genutzt werden.
Das Register ist infolge der Erkenntnis entstanden, dass die globale Gesundheits-Community nicht in der Lage war, während des Ebola-Ausbruchs 2014 zeitnah Konsensdaten zu erfassen.
„Als die Zahlen der COVID-19-Pandemie stiegen, wurde schnell offensichtlich, dass sich mit dem Virus auch eine auf Anekdoten und Meinungen basierende Medizin ausbreitete“, sagte Dr. Allan J. Walkey, außerordentlicher Professor für Medizin, Boston University, und einer der Prüfärzte der VIRUS-Studie. „Wir erkannten, dass ein dringender Bedarf an zuverlässigen Daten besteht, die als Entscheidungshilfe bei der Behandlung dieses Anstiegs an schwerkranken Patienten verwendet werden könnten.”
Das Register zeigt, wie schnell wesentliche Daten erfasst werden können, wenn der Wille zur Zusammenarbeit gegeben ist. Vier Tage, nachdem die Weltgesundheitsorganisation COVID-19 zur Pandemie erklärte, besprachen Dr. Vishakha Kumar, M.B.A., Prüfarzt und amtierender Forschungsleiter bei SCCM Discovery, und Dr. Kashyap die Notwendigkeit zu einem Register. Vier Tage später, an einem Sonntag, twitterte Dr. Walkey: „Baut irgendjemand ein COVID-Register auf?“ und am Ende des Tages hatte die Gruppe einen Plan für die Durchführung.
„Es ist erstaunlich, wie schnell die globale medizinische Community bei der Bemühung zusammenkam, Daten zu teilen und dieses neue Virus zu verstehen, um dadurch die Behandlung von Patienten zu verbessern“, sagte Dr. Greg Martin, M.S., FCCM, gewählter Präsident von SCCM und exekutiver Divisionsleiter, Lungen-, Allergie, Intensivpflege- und Schlafmedizin, Emory University School of Medicine. „Ärzte an der Front dieser Pandemie stellen die Daten in ihrer Freizeit bereit. Die Informationen, die sie erfassen, helfen nicht nur bei der Versorgung der derzeitigen COVID-19-Patienten, sondern geben auch vor, wie wir Patienten bei zukünftigen Ausbrüchen betreuen. Je mehr Zentren in aller Welt teilnehmen, desto bessere Daten werden wir alle zur Verfügung haben.“
Das Register wurde am 31. März eröffnet, und sechs Wochen später wurden mehr als 3.400 Fälle eingegeben. Jeder Standort erfasst die Eigenschaften der Patienten, Behandlungsstrategien und Ergebnisse, die anonymisiert werden, d.h., dass Namen und sonstige identifizierende Informationen nicht in die Datenbank aufgenommen werden.
Alle Zentren, die COVID-19-Patienten behandeln, werden zur Teilnahme aufgefordert.
Das von der Gordon and Betty Moore Foundation finanzierte, ein Jahr lang dauernde Projekt wird Daten für zukünftige Studien zu COVID-19 bereitstellen. Die Ergebnisse von VIRUS werden besonders hilfreich für das Patientenmanagement bei einer möglichen zweiten Welle der Pandemie sein. Die Datenbank richtet auch eine Infrastruktur für eine schnelle Datenerfassung, Analyse und Verbreitung ein, die bei zukünftigen Ausbrüchen eine schnelle Reaktion ermöglicht. Die Gordon and Betty Moore Foundation fördert bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen, Umweltschutz, Verbesserung der Patientenbetreuung und Bewahrung des besonderen Charakters der Bay-Region.
Im Jahr 2016 gründete das SCCM Discovery, um eine zentrale Ressource für die Verknüpfung von Forschern der Intensivpflege bereitzustellen, um die Forschung zu Krankheiten und Verletzungen der Intensivpflege zu erweitern. Dabei werden zentralisierte Netzwerke und konkrete Ressourcen wie Datenspeicherung und -verwaltung, statistische Unterstützung und andere Anforderungen bereitgestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter Discovery VIRUS COVID-19 Registry.
Über Mayo Clinic
Mayo Clinic ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Innovation in der klinischen Praxis, Bildung und Forschung und der Bereitstellung von Mitgefühl, Know-how und Antworten für alle verschrieben hat, die Heilung benötigen. Besuchen Sie das Mayo Clinic News Network um weitere Neuigkeiten zur Mayo Clinic zu erhalten und gewinnen Sie einen Einblick in die Mayo Clinic, um sich ein noch besseres Bild über deren Arbeit zu machen.
Die Society of Critical Care Medicine (Gesellschaft für Intensivmedizin)
Die Society of Critical Care Medicine (SCCM) ist die größte gemeinnützige medizinische Organisation, welche die Exzellenz und Einheitlichkeit der Praxis der Intensivpflege fördert. Mit Mitgliedern in mehr als 100 Ländern ist SCCM die einzige Organisation, die alle beruflichen Komponenten des Intensivpflegeteams vertritt. Die Gesellschaft bietet eine Reihe von Aktivitäten, welche die Qualität der Patientenpflege, der Ausbildung, Forschung und Förderung sicherstellen. SCCMs Mission besteht darin, die höchste Qualität bei der Pflege aller schwerkranken oder schwer verletzten Patienten zu gewährleisten. Besuchen Sie sccm.org für weitere Informationen. Folgen Sie @SCCM oder besuchen Sie uns auf Facebook.