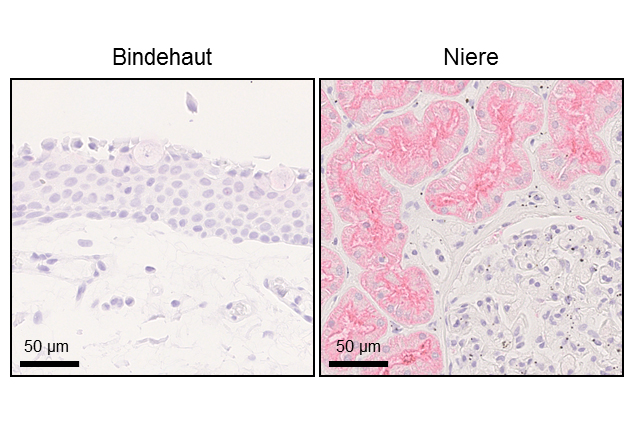Experten der Universität Leipzig sind noch auf der Suche nach Probanden zwischen 13 und 17 Jahren
Ein Expertenteam des Instituts für Psychologie der Universität Leipzig will in einem neuen Forschungsprojekt zur WhatsApp-Kommunikation Jugendlicher untersuchen, ob sich daraus Rückschlüsse auf eine drohende Depression ziehen lassen. Der Kinder- und Jugendpsychologe Prof. Dr. Julian Schmitz und seine Kollegen sind daher im Raum Leipzig aktuell auf der Suche nach insgesamt 40 depressiven und gesunden jungen Menschen zwischen 13 und 17 Jahren, um deren WhatsApp-Kommunikation anonym zu vergleichen und auf bestimmte Inhalte hin zu analysieren, die auf eine Depression hinweisen. Das Forschungsprojekt der Universität Leipzig gehört zu einer umfassenden Studie eines größeren Konsortiums zu dieser Problematik unter Leitung der Universität Tübingen, an dem auch die Universität Würzburg und die TU Dresden beteiligt sind.
„Wir wollen zunächst herausbekommen, ob die WhatsApp-Kommunikation
überhaupt ein Marker ist, um eine depressive Erkrankung zu erkennen“,
sagt Schmitz. Dazu werden die Daten der Probanden, die beispielsweise in
Krankenhäusern oder psychiatrischen Ambulanzen in Behandlung sind und
so auf die Studie gekommen sind, auf bestimmte negative Inhalte
untersucht. Ein wichtiger Punkt ist für die Forscher auch, wieviel Zeit
die jungen Menschen am Handy oder Tablet verbringen und wie oft sie es
aus- und einschalten. Fest steht, dass eine Depression die
Kommunikationsmuster der Betroffenen beeinflusst. „Die einen
verschließen sich vor ihrer Umwelt, haben weniger Interaktion in den
sozialen Medien, andere sind ständig online und kommunizieren verstärkte
negative Gedanken und Gefühle. Im realen Leben ist es definitiv so,
dass sich die Betroffenen eher zurückziehen“, erläutert Schmitz.
Untersucht werde auch, mit wie vielen Personen die Jugendlichen Kontakt
haben. „Wenn depressive Menschen ihre sozialen Kontakte nicht mehr
pflegen, ist die Frage, ob das über WhatsApp messbar ist. Das wollen wir
herausbekommen“, so der Psychologe.
Auch die Art der
Kommunikation werde durch diese Erkrankung verändert. Über eine App, die
auf den Handys der Jugendlichen installiert wird, und bestimmte
Computer-Algorithmen suchen die Forscher deshalb nach einer Häufung von
Wörtern oder Emojis, die negative Emotionen ausdrücken. Da depressive
Menschen stark mit sich selbst beschäftigt sind, werde in den
WhatsApp-Texten auch nach gehäuften „Ich“-Formulierungen gesucht, die
den für die Erkrankung typischen Egozentrismus widerspiegeln.
Schmitz betont, dass die Auswertung der Daten, die bis zum Sommer kommenden Jahres gesammelt werden sollen, anonym erfolgt und diese verschlüsselt übertragen werden. Zudem stehen alle an dem Projekt Beteiligten unter Schweigepflicht. Innerhalb des Konsortiums werten die Forscher WhatsApp-Daten vom Jugendlichen aus Leipzig, Tübingen, Dresden und Würzburg aus. „Es ist das erste Mal, dass die WhatsApp-Kommunikation in diesem Zusammenhang untersucht wird“, betont Schmitz. Wenn sich herausstellt, dass dies ein gangbarer Weg ist, um diese Erkrankung zu erkennen, könnten über das Handy beispielsweise helfende Hinweise an die Betroffenen via WhatsApp verschickt werden. Auch der behandelnde Therapeut könnte auf diesem Weg informiert werden. Nicht zuletzt haben Schmitz zufolge auch die Krankenkassen Interesse an dem Forschungsprojekt, da die Resultate unter anderem für die klinische Versorgung von depressiven Patienten genutzt werden könnten.
Wir haben bei der Uni Leipzig nachgefragt, welche Daten die Krankenkassen tatsächlich bekommen werden. Wie es möglich sein wird, wenn die Daten anonymisiert sind, Hinweise für die Betroffenen per WhatsApp zu schicken.
Hier die sehr schnelle Antwort von Prof. Dr. Schmitz, Uni Leipzig.
„In der Studie werden die Daten anonymisiert erhoben zu Forschungszwecken; sollte es weitere Entwicklungen geben kann eine mögliche App, die im Gesundheitsbereich eingesetzt wird, dann auch für mögliche Nachrichten genutzt werden beispielsweise zwischen Patient und Psychotherapeut (als Perspektive). Aktuell erhalten Krankenkassen keine Daten aus der App bzw. auch die Forschungsdaten werden keiner Krankenkasse direkt zur Verfügung gestellt.“
Interessierte Jugendliche können sich unter den folgenden Kontaktdaten zur Studie anmelden: Telefon 0341 9735991 und E-Mail whatsapp-studie@psychologie.uni-leipzig.de.