dafür sorgen, dass sich Krankheiten in Megacities zukünftig nicht zu Epidemien entwickeln?
Archiv für den Monat: September 2014
Zöliakie: Rund um die Autoimmunerkrankung existieren viele Irrtümer
Zu den weit verbreiteten Fehlannahmen, so die Erfahrung des Internisten, gehöre etwa die Einschätzung, Zöliakie sei vorwiegend eine Erkrankung des Kindesalters, die sich in der Pubertät „auswachse“. „Tatsächlich sind zum
Zeitpunkt der Diagnose Frauen im Mittel zwischen 40 und 45 Jahre alt, bei Männern gibt es zwei Altersgipfel – zwischen 10 und 15 und zwischen 35 und 40 Jahren.“ Zöliakie sei zudem eine lebenslange Erkrankung. Einmal diagnostiziert, sollten Betroffene ihr ein Leben lang durch glutenfreie Ernährung entgegenwirken. „Entgegen häufiger Annahmen ist eine glutenfreie Ernährung auch dann empfohlen, wenn eine nachgewiesene Zöliakie keine offensichtlichen Symptome verursacht und Gluten vermeintlich gut vertragen wird“, so der Experte. Weil eine unbehandelte Zöliakie meist mit einem Mangel an Vitaminen, Spurenelementen sowie mit Blutarmut einhergeht, kann sie sich bei Kindern negativ auf das Wachstum und die Knochenqualität auswirken. Bei Erwachsenen erhöhe eine unentdeckte oder unbehandelte Zöliakie das Risiko für Komplikationen – etwa für die Entwicklung weiterer Autoimmunerkrankungen, in seltenen Fällen sogar für Lymphome des Dünndarms.
Um eine Zöliakie nachzuweisen, untersuchen Mediziner das Blut auf die in der Regel erhöhten Autoantikörper gegen das Enzym „Gewebetransglutaminase“. Wenn die Patienten sich bis zuletzt glutenhaltig ernährt haben, können die Ärzte damit die Erkrankung in der Regel von ähnlichen Leiden wie der Weizenallergie oder einer Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität unterscheiden. Ist das Ergebnis nicht eindeutig, helfen genetische Risikomarker im Blut die Zöliakie zu diagnostizieren. Den Verdacht bestätigt dann die Untersuchung von Gewebeproben aus dem Dünndarm.
Stellen Sie sich vor, Ihr Arzt würde …..
….. Ihre vollständige Krankenakte zur Einsicht für alle in einen Schaukasten vor seiner Praxis einstellen. Würden Sie diesem Arzt auch weiterhin vertrauen? Oder würden Sie sagen, ist doch ok. Ich habe nichts zu verbergen?
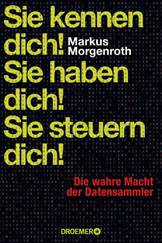 Dreh dich nicht um, die Datendiebe gehen um
Dreh dich nicht um, die Datendiebe gehen um
Könnte man die Verfolger in Sachen Datenklau sehen, würden wir uns besser schützen. Da sie unsichtbar sind, vergessen wir nach großen Datenskandalen allzu leicht wieder, dass sie ständig hinter unseren Daten her sind.
Aktuell warnen Politiker vor allzu sorglosem Umgang mit wichtigen Unternehmensdaten. Das neue Zauberwort heißt „IT-Sicherheit“. Stromversorger, Krankenhäuser, die Bahn, Fluggesellschaften und andere wichtige Dienstleister, Firmen und Einrichtungen müssen mehr für ihre IT-Sicherheit tun, lautet die neueste Erkenntnis der Bundesregierung. Ein neues Gesetz soll dafür sorgen. Es ist sogar eine Meldepflicht für Hackerangriffe vorgesehen.
Neu ist nicht, dass Kriminelle stets einen Schritt dem Gesetzgeber voraus sind. Doch hier geht es um weit mehr als nur diesen einen Schritt. Die Entwicklung wurde regelrecht verschlafen. Jetzt wird es schwierig werden, den immer massiveren Angriffen von Hackern und der übermächtigen Ausspähung durch Geheimdienste entgegenzuwirken.
Trotz eines weltweiten massiven Datenklaus nutzen noch immer zu wenige Firmen und Institutionen und noch weniger Privatpersonen eine E-Mailverschlüsselung.
Selbst Ärzte, Rechtsanwälte und Steuerberater, die allesamt sensible Daten verwalten, verschicken E-Mails mit wichtigen Dokumentenanhängen unverschlüsselt. Ja, sie fragen oft noch nicht einmal ihre Patienten, Klienten und Mandanten, ob diese eine Verschlüsselung wünschen. Wenn letztere dies verlangen, dann werden sie als überängstliche Störenfriede abgestempelt. Geradezu krotesk wird es, wenn ein Steuerberater oder Anwalt von seinem eigenen Arzt das Höchstmaß an Datenschutz verlangt, das er seinen eigenen Kunden jedoch nicht einmal ansatzweise zukommen lässt.
Nach einem langen „Kampf“ mit meinem Steuerberater in Sachen E-Mailverschlüsselung, wollte ich wissen, was die Berufsverbände ihren Mitgliedern zu diesem Thema an Informationen und Hilfestellungen anbieten.
Nachgefragte habe ich schriftlich bei der Bundessteuerberaterkammer, der Bundesrechtsanwaltskammer, der Bundesärztekammer und der DATEV.
Peggy Fiebig, die Pressesprecherin der Bundesrechtsanwaltskammer hat sich sofort telefonisch gemeldet. Sie teilte mit, dass derzeit an einem elektronischen Postfach für den E-Mail-Austausch zwischen Gericht und Anwalt und den Anwälten untereinander mit Hochdruck gearbeitet wird. Es ist allerdings nicht vorgesehen, diese elektronischen Postfächer für den Schriftverkehr zwischen Anwalt und Mandant zu nutzen.
Mahnanträge werden bereits heute elektronisch eingereicht. Für die Umsetzung sind die Bundesländer zuständig. In Hessen funktioniert die Verschlüsselung bereits sehr gut. In Bayern und Baden-Württemberg hingegen ist das nicht der Fall.
Es bleibt den Rechtsanwälten überlassen, ob sie ihre Mails verschlüsseln oder nicht. Die Realität sieht leider so aus, dass wichtige Dokumente unverschlüsselt per E-Mail hin- und hergeschickt werden.
Das erstaunt um so mehr, da jede Rechtsanwältin und jeder Rechtsanwalt gemäß § 12a BRAO vor seiner Zulassung diese Eid ablegen muss: „Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“ Da zu diesen Pflichten die Verschwiegenheit gehört, ist es um so erstaunlicher, dass die E-Mailverschlüsselung nicht als selbstverständlich gilt.
Der Fairhait halber muss ich hier erwähnen, dass es umgekehrt auch Mandanten gibt, die eine E-Mailverschlüsselung ablehnen, weil es ihnen zu aufwendig ist. Dies hat in einem längeren Gespräch auch Jari Hansen von der Initiative „Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung e.V. in Hamburg bestätigt.
Die DATEV (das Softwarehaus und IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren Mandanten) reagierte ebenfalls schnell auf meine Anfrage. Auch auf der Homepage der DATEV finden sich viele Informationen zum Thema Datenschutz und E-Mailverschlüsselung. Unter der Überschrift „Laxer Umgang mit E-Mails gefährdet Unternehmensdaten“ will die DATEV Mittelständler für mehr E_Mail-Sicherheit sensibilisieren. Darin wird auch auf die Nutzung von Clouds eingegangen.
Die Bundessteuerberaterkammer lässt sich Zeit mit einer Antwort.
Am 15. Juli 2014 teilte man mir mit, dass die Antwort in Arbeit sei. Heute haben wir den 22. August 2014.
Und die Bundesärztekammer hat erst gar nicht reagiert. Vielleicht liegt es daran, dass ihr Präsident – Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery – WhatsApp nutzt, wie er in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zugegeben hat. Wer derartige Datenkraken nutzt, hat wohl wenig übrig für das Thema E-Mailverschlüsselung, könnte man schlussfolgern.
Auf der Homepage der Bundesärztekammer findet man ein aktuelles, umfangreiches Dokument zum Datenschutz in der Arztpraxis, das auch detaillierte Informationen zum Umgang mit E-Mail-Verkehr, Datenspeicherung und der Weitergabe an externe Stellen enthält. Das PDF kann hier heruntergeladen werden http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/Schweigepflicht_2014.pdf.
Hier zwei Auszüge:
„Übermittelt der Arzt patientenbezogene Daten über ein öffent-
liches Datennetz (Internet), so ist sicherzustellen, dass der Zu-
griff Unbefugter auf die Dokumente ausgeschlossen ist. Die zu
übermittelnden Daten sollten daher durch ein hinreichend siche-
res Verfahren verschlüsselt werden.
Umgang mit externen Speichermedien
Es gibt zunehmend Angebote der Industrie für elektronische Pa-
tientenakten auf externen Speichermedien (USB-Sticks). Diese
sollen in der Arztpraxis angeschlossen werden, um Daten auszu-
lesen oder neue Daten darauf zu speichern. Von außen ist nicht
erkennbar, ob sich auf dem USB-Stick Schadsoftware befindet,
die – sogar durch bloßes Stecken – den Rechner des Arztes infi-
zieren und z. B. Patientendaten löschen, manipulieren oder stehlen kann.“
Das 10-Seiten starke Papier lässt keinen Zweifel daran, dass die Bundesärztekammer sich um den Datenschutz in den Arztpraxen kümmert. Problematisch ist die Umsetzung, denn dafür sind die Ärzte selbst verantwortlich. Und da Ärzte keine IT-Spezialisten sind, fällt es dem einen oder anderen Arzt schwer, sich auf immer umfangreicher werdende Datenschutz-Herausforderungen einzustellen und diese umzusetzen, nicht zuletzt deshalb, weil dies auch mit Kosten verbunden ist, die gerade Kassenärzte nicht honoriert bekommen. Die gesetzlichen Krankenkassen könnten hier Abhilfe schaffen, indem sie den Kassenärzten eine finanzielle IT-Pauschale erstatten, die einen Teil des Mehraufwandes auffängt. Diese Kostenerstattung sollte als wichtige Investition zum Schutz der Patientendaten auch von der Politik befürwortet werden.
Für „Otto-Normalbürger“ muss die E-Mailverschlüsselung nicht erst in ferner Zukunft, sondern auch heute schon ein wichtiges Thema sein.
Hier stellt sich die berechtigte Frage, warum ignorieren so viele Menschen, dass E-Mailverschlüsselung uns alle angeht. Auch dann, wenn wir selbst keine E-Mails verschicken.
Der Chaos-Computer-Club zeigt in einem Video wie einfach sich die Verschlüsselung umsetzen lässt. Daran kann es also nicht liegen.
Unbestritten ist auch, dass man nicht jede E-Mail verschlüsseln muss. Der zusätzliche Aufwand lohnt sich immer, wenn es sich um wichtige bis sehr wichtige Dokumente handelt.
Ein kleines Szenario zum Schluss:
Stellen Sie sich vor, die Finanzämter würden die Steuererklärungen der Bundesbürger in öffentlichen Schaukästen für jedermann einsehbar ausstellen.
Würden Sie dann beim Anblick Ihrer Steuererklärung noch lapidar sagen: „Ist ok, ich habe ja nichts zu verbergen?“
Ria Hinken, Freiburg
Die Anzahl der Menschen, die mit unzähligen Geräten, wie Smartphones, Fitness-Armbänder, Kameras oder Smart Watches sich selbst vermessen und auf diese Weise sensible persönliche Daten erfassen, wächst rasant. Rund um die Uhr messen die Geräte eine enorme Anzahl von Parametern, unter anderem den Blutdruck, die Herzfrequenz, das Stresslevel, den Kalorienverbrauch, den Sauerstofflevel des Blutes, die Art und Dauer von sportlichen Aktivitäten, die Schlafdauer und ‑qualität, ja sogar wann, wie lange und wie oft wir Sex haben. Der Handel mit diesen Daten ist bereits ein riesiges Geschäft und wird in Zukunft stark zunehmen, denn mit den kürzlich von Apple vorgestellten Produkten ist der Trend der Selbstvermessung endgültig im Massenmarkt angekommen.
Der Datenanalyst Markus Morgenroth warnt: „Dies ist eine äußerst beunruhigende Entwicklung, da den meisten Verbrauchern nicht bewusst ist, welche negativen Auswirkungen und Konsequenzen die Auswertung dieser sensiblen Daten, oft auch noch Jahre später, für den Einzelnen haben kann.“ Diese Daten enthalten oft brisante Informationen, die man nur in Ausnahmefällen freiwillig mit anderen Unternehmen teilen sollte.
Sie sind gesund? Sie treiben Sport? Sie haben nichts zu verbergen? Prima! Doch was passiert, wenn aus Ihren Daten falsche Schlüsse gezogen werden, wenn Fehler bei den Auswertungen passieren, Daten in die falschen Hände gelangen? Datenhändler und die Pharmaindustrie, aber auch Ihr Arbeitgeber oder Ihre Versicherung haben sicherlich großes Interesse an Ihren Gesundheitsdaten.
 Der Datenexperte Markus Morgenroth empfiehlt, sehr genau zu überdenken, ob der Einsatz der Gesundheits-Apps/Gadgets wirklich notwendig ist. Wo immer möglich, verzichten Sie auf die Erfassung von Gesundheitsdaten, bzw. überprüfen Sie die Privatsphäreeinstellungen der Apps/Gadgets. Machen Sie sich bewusst, dass all die sensiblen Daten beim Anbieter gespeichert werden und es kaum Möglichkeiten gibt nachzuverfolgen, was mit den Daten passiert. Besondere Gefahr besteht bei kleineren Unternehmen, die oftmals im Ausland sitzen, anderen Gesetzgebungen unterliegen und das Thema Datenschutz nicht immer mit dem nötigen Ernst behandeln.
Der Datenexperte Markus Morgenroth empfiehlt, sehr genau zu überdenken, ob der Einsatz der Gesundheits-Apps/Gadgets wirklich notwendig ist. Wo immer möglich, verzichten Sie auf die Erfassung von Gesundheitsdaten, bzw. überprüfen Sie die Privatsphäreeinstellungen der Apps/Gadgets. Machen Sie sich bewusst, dass all die sensiblen Daten beim Anbieter gespeichert werden und es kaum Möglichkeiten gibt nachzuverfolgen, was mit den Daten passiert. Besondere Gefahr besteht bei kleineren Unternehmen, die oftmals im Ausland sitzen, anderen Gesetzgebungen unterliegen und das Thema Datenschutz nicht immer mit dem nötigen Ernst behandeln.
Mut gegen Macht
Ab 13. Oktober im WDR Fernsehen: Mut gegen Macht – Neue fünfteilige Doku-Reihe
Es geht um Menschen, die ihr gutes Recht durchsetzen wollen und nicht klein bei geben, obwohl sie sich manchmal machtlos fühlen. Wie „David gegen Goliath“ kämpfen sie gegen Behörden, Institutionen oder auch große Unternehmen. Die brisanten Fälle, die die fünfteilige Reihe präsentiert, zeigen aktuelle gesellschaftliche und politische Missstände aus den Bereichen Justiz, Gesundheit, Wirtschaft und Arbeit auf.

- © WDR
„Mit „Mut gegen Macht“ setzen wir thematisch einen klaren Akzent und bieten im WDR Fernsehen montags zur Primetime um 20.15 Uhr anspruchsvolle und hochwertige Dokumentationen,“ sagt WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn. „Die Menschen in unseren Filmen finden sich nicht damit ab, Opfer zu sein. Sie wehren sich und zeigen, dass Mut sich lohnt.“ Die Online-Seite www.mutgegenmacht.wdr.de bietet Zusatzinformationen und Links und ist Kommunikationsplattform für Kommentare, Fragen und Anregungen der Zuschauer. Neuigkeiten und Bonusmaterialien rund um die Filme werden über Facebook, Google+ und Twitter kommuniziert. Auch das WDR-Radio begleitet „Mut gegen Macht“ mit eigenen Beiträgen.
Den Auftakt der Doku-Reihe macht der Film: „Mut gegen Macht: Wenn Gerichtsgutachten Familien zerstören“ von Jan Schmitt und Justine Rosenkranz. Gutachter an Familiengerichten können über die Zukunft ganzer Familien entscheiden – über die Frage, ob ein Kind beim Vater oder der Mutter lebt, wie oft ein Elternteil es sehen darf oder ob es sogar in einem Heim leben muss. Doch es gibt zahlreiche Gutachten, die nachgewiesenermaßen gravierende Mängel aufweisen und zu Urteilen führten, die ganze Familien zerstört haben. Und fehlerhafte Gutachten sind keine Seltenheit, wie eine Studie der Fernuniversität Hagen belegt: Danach „erfüllt nur eine Minderheit die fachlich geforderten Qualitätsstandards“. Eigentlich kein Wunder: Um als Gutachter am Familiengericht tätig sein zu dürfen, braucht man keinerlei Qualifikation. Jeder kann Familiengutachter werden. Und Fehler in Gutachten fallen oft nicht auf, weil die Richter – ihrerseits ohne psychologische Ausbildung – die einzige Kontrollinstanz sind. Dadurch haben Gutachter viel Macht vor Gericht, nur mit Mut und Durchhaltewillen können Eltern gegen deren Expertise vorgehen. Der Film „Wenn Gerichtsgutachten Familien zerstören“ geht dramatischen Fällen nach, erzählt die Leidensgeschichten betroffener Eltern und Kinder und zeigt, dass unser Justizsystem hier dringenden Reformbedarf hat.
Redaktion: Petra Nagel (DVD kann angefordert werden)
Weitere Sendetermine der Reihe „Mut gegen Macht“:
20.10.: Nicht ohne meine Kinder (Alexandra Ringling)
Redaktion: Sebastian Bellwinkel (NDR), Jo Angerer (WDR)
27.10.: Für Gottes Lohn (Wolfgang Minder)
Redaktion: Emanuela Penev
3.11.: Die Milchrebellen (Valentin Thurn)
Redaktion: Angelika Wagner
10.11.: Behandlungsfehler – Der Kampf um Entschädigung (Thomas Becker)
Redaktion: Martin Suckow
Das verheimlichte Leiden
Gegen das verheimlichte Leiden
DGVS-Experten: Stuhlinkontinenz ist behandelbar
Berlin – Schätzungsweise fünf Millionen Menschen in Deutschland können die Ausscheidung ihres Stuhls nicht bewusst kontrollieren. Ursache ist mitunter ein Schlaganfall oder auch eine Beckenbodenschwäche. Betroffene schämen sich dafür und versuchen ihr Leiden geheim zu halten. Dabei gibt es wirksame Therapien, mit denen Ärzte Stuhlinkontinenz behandeln und die Beschwerden lindern können, teilt die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) mit.
„Stuhlinkontinenz darf kein Tabuthema sein“, sagt DGVS-Beirat Professor Dr. med. Peter Layer, Direktor der Medizinischen Klinik am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg. „Für die meisten Patienten gibt es langfristig wirksame Hilfen.“ Der erste Schritt dabei sei ein offenes Gespräch mit dem Hausarzt. Dieser stellt, wenn nötig, eine Überweisung zum Gastroenterologen aus.
Der Magen-Darm-Spezialist kann dann mit Hilfe einer Endoskopie oder Ultraschall feststellen, ob eine chronische Darmerkrankung vorliegt und den Schließmuskel untersuchen. Anhand der Ergebnisse entscheidet er, welche Therapie für den Patienten in Frage kommt. „Eine häufige Ursache ist beispielsweise eine Schwächung der Beckenbodenmuskulatur, also jener Muskelgruppe, die die Ausgänge von Blase und Darm dicht hält“, erklärt der Experte. Auch Verletzungen durch Geburten und Operationen können die Funktion des Schließmuskels beeinträchtigen. „Bei Menschen mit Diabetes mellitus oder bei Schlaganfallpatienten kann die Nervenwahrnehmung am Darmausgang auch derart abgeschwächt sein, dass der Patient den Stuhldrang nicht mehr bemerkt“, fügt Layer hinzu.
Einem Viertel der Betroffenen hilft es schon, sich anders zu ernähren. „Eine ballaststoffreiche Ernährung erhöht Volumen und Konsistenz des Stuhls, so dass dieser nicht mehr so leicht austreten kann“, erklärt Professor Layer. Medikamente, die den Stuhl fester machen oder die Darmaktivität verringern, unterstützen dabei.
Langfristig lassen sich Beckenboden und Schließmuskel mit gymnastischen Übungen trainieren. Das sogenannte Biofeedback verstärkt den Trainingseffekt. Dabei führt der Arzt eine Sonde durch den After ein, die die Spannung in der Beckenbodenmuskulatur misst. Das Ergebnis liest der Patient auf einer Skala ab. „Patienten, bekommen so ein besseres Gespür für ihre Muskulatur“, berichtet Layer. „Fast 80 Prozent der Behandelten lernen den Schließmuskel wieder zu kontrollieren.“
Hilft die konservative Therapie nicht weiter, kommen auch chirurgische Verfahren in Frage. „Wenn beispielsweise ein Dammriss vorliegt, kann ein Chirurg den defekten Schließmuskel operativ korrigieren“, sagt Layer. Eine weitere Möglichkeit bietet die sakrale Nervenstimulation: dabei baut der Chirurg Elektroden am Darmausgang ein, die den Schließmuskel stimulieren. Mit einer kleinen Fernbedienung kann der Patient diese Elektroden selbst steuern, wenn ein Toilettengang ansteht.
Stuhlinkontinenz trifft Menschen in jedem Alter, doch besonders häufig sind Ältere die Leidtragenden. So kommt eine Erhebung aus den USA zu dem Ergebnis, dass über 15 Prozent der über 70-Jährigen unter Stuhlinkontinenz leiden. Die Betroffenen bemerken den Stuhldrang entweder gar nicht oder können den Stuhl nicht lange genug halten, um die Toilette zu erreichen. Aus Scham trauen sie sich nicht über ihr Problem zu sprechen und versuchen allein mit der Situation zurechtzukommen – mit der Folge, dass sie sich immer mehr zurückziehen und vereinsamen. Oft wird das Problem fälschlich als „Durchfall“ bezeichnet und dann fehlbehandelt. Die DGVS empfiehlt darum auch Angehörigen das Problem anzusprechen und die Betroffenen auf die Möglichkeit medizinischer Hilfe hinzuweisen.
Literatur:
Current and Emerging Treatment Options for Fecal Incontinence.
Rao SS., Journal of Clinical Gastroenterology, 2014 Oct; 48(9):752-64
Arthrose verursacht zu viele Arbeitsausfälle
Wie Patienten Berufsleben und Alltag erfolgreich meistern
Von Vorteil ist, wenn man rechtzeitig mit vorbeugenden Maßnahmen anfängt. Eine sehr erfolgreiche Methode ist die „Feldenkrais-Methode“. Der Körper verändert Bewegungsmuster, wenn Schmerzen auftreten, die länger anhalten oder immer wieder kehren. Mit der Feldenkrais-Methode führt man den Körper wieder an gesunde Bewegungsmuster heran. Einmal die Woche eine Stunde üben hilft schon sehr viel. Wer bereits Rückenprobleme oder gar Arthrose hat, kann natürlich auch dann noch viel Gutes mit dieser Methode für sich und den eigenen Bewegungsapparat tun.
Arthrose verursacht jährlich mehr als sieben Milliarden Euro direkte Krankheitskosten. Das belastet nicht nur das deutsche Gesundheitssystem. Auch vielen Arbeitgebern gehen Arbeitsstunden und -jahre wegen Fehlzeiten und Frühberentung ihrer Mitarbeiter verloren. Gleichzeitig sinkt die Lebensqualität der Betroffenen dramatisch. Orthopäden raten Arthrose-Patienten zu einer individuellen Therapie und täglichem Training für die Gelenke. So können sie Schmerzen reduzieren und ihr Berufsleben trotz Krankheit bewältigen. Im Rahmen des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU), der vom 28. bis 31. Oktober in Berlin stattfindet, erläutern Experten, wie tägliches Training, Tapes und Schuheinlagen den Alltag von Arthrose-Patienten erleichtern.
„Jährlich gehen 70 000 verlorene Erwerbstätigkeitsjahre und 10 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage auf das Konto der häufigsten Gelenkerkrankung Arthrose“, betont Dr. med. Johannes Flechtenmacher, Kongresspräsident des DKOU 2014. Dabei sei die häufigste Ursache die Kniegelenksarthrose. Um Betroffenen ein längeres Berufsleben zu ermöglichen, sei es besonders wichtig, Risiko-Patienten schnell zu identifizieren und ihnen eine geeignete, auf ihren Lebensstil angepasste Therapie anzubieten, erklärt der niedergelassene Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. „Nur der frühe Einsatz einer Kombination aus medikamentösen sowie nicht-medikamentösen Therapieverfahren gewährleistet, dass akute Beschwerden seltener auftreten und Patienten so wenig wie möglich in ihrem Alltag und Berufsleben eingeschränkt sind.“
Der wichtigste Aspekt für den Therapieerfolg ist die Beratung des Patienten, wie Studien zeigen. Daher hat die Kommunikation mit dem Betroffenen in der Arthrose-Behandlung besondere Bedeutung. „Der behandelnde Arzt muss den Patienten umfassend informieren – über die Erkrankung, ihren möglichen Verlauf, die Medikation und über Möglichkeiten, selbst Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen zu können“, fordert Flechtenmacher.
Um Schmerzen und Immobilität zu reduzieren, empfehlen Orthopäden und Unfallchirurgen die Physiotherapie: „Gezieltes Training stärkt die Muskulatur um das von Arthrose geschädigte Gelenk. Das erhält die Beweglichkeit“, erklärt Professor Dr. med. Johannes Stöve, Chefarzt der Orthopädischen und Unfallchirurgischen Klinik am St.-Marienkrankenhaus Ludwigshafen. „Zu Beginn sollte das Training unter professioneller Anleitung erfolgen. Anschließend muss es aber unter Eigenregie konsequent im Alltag fortgesetzt werden.“
Viele Patienten profitieren auch von Wärme- und Kältetherapie oder der Orthopädietechnik, wie Tapes und Schuheinlagen. „Hier ist die Studienlage allerdings noch unzureichend, um objektive Empfehlungen auszusprechen“, betont Stöve. Wärme wird zumeist im nicht akuten Stadium zur besseren Durchblutung und Muskelentspannung eingesetzt. Die Kältetherapie hingegen lindert Schmerzen, ebenso Gehstützen und Gehhilfen sowie Schuheinlagen. Sie verbessern zudem die Funktion, beispielsweise des Kniegelenks. Auch das alleinige Tapen eines arthrotischen Kniegelenks oder das Tragen von Knieorthesen verringert bereits Schmerzen.
Welche weiteren Methoden Menschen mit Arthrose helfen, Alltag und Berufsleben schmerzfrei und mit mehr Mobilität zu bewältigen und worauf sie bei ihrer Therapie achten sollten, erklären Orthopäden und Unfallchirurgen auf einer Pressekonferenz am 29. Oktober 2014 anlässlich des DKOU in Berlin, der von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädischen Chirurgie (DGOOC) sowie dem Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) ausgerichtet wird.
Literatur:
OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines, Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, Abramson S, Altman RD, Arden N, Bierma-Zeinstra S, Brandt KD, Croft P, Doherty M, Dougados M, Hochberg M, Hunter DJ, Kwoh K, Lohmander LS, Tugwell P. Osteoarthritis Cartilage. 16:137-62, 2008
Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 54 Arthrose, Robert Koch Institut, Statistisches Bundesamt, Juni 2013
Gesunder Lebensstil schützt vor grünem Star
Bluthochdruck, Übergewicht und Schlaf-Apnoe schaden den Augen
Berlin – Gefäßverkalkung, Übergewicht, Nikotin und Schlafapnoe schädigen nicht nur das Herzkreislaufsystem, sondern auch die Augen. So zeigt eine Untersuchung, dass jeder zweite Glaukom-Patient an Bluthochdruck, jeder dritte an einem erhöhten Blutfettspiegel oder Diabetes leiden. Gesunde Ernährung und Bewegung sollten demnach auch ein Rezept gegen Augenleiden sein, rät die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG). Laufen oder Fahrradfahren kann den Augeninnendruck vorübergehend senken und somit das Risiko für einen fortschreitenden Sehnervenschaden vermindern.
In Deutschland leiden rund 800.000 Menschen an einem grünen Star, auch Glaukom genannt. Bisher galt ein Augeninnendruck ab 21 mmHg auf der Quecksilbersäule als einzig bekannter Risikofaktor für die Augenerkrankung. Doch die Forschung der vergangenen Jahre hat ergeben, dass Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, Übergewicht, Nikotingenuss und Diabetes mellitus Typ 2 offenbar ebenfalls die Entwicklung eines Glaukoms fördern können. „Diese Faktoren schädigen erwiesenermaßen die Gefäße und können zu einer Fehlregulation der Gefäße führen“, erläutert Professor Dr. med. Johann Roider, Kongresspräsident der DOG. „Und damit vermutlich auch die Gefäße, die den Sehnerv und die Netzhaut versorgen.“ In der Folge steigt der Augeninnendruck, und die Sehkraft schwindet.
So zeigt eine Fallstudie aus Taiwan, in der Daten von mehr als 76.000 Glaukompatienten analysiert wurden, dass jeder zweite unter Bluthochdruck und jeder dritte an einem erhöhten Blutfettspiegel oder Diabetes leidet. „Das bedeutet nicht, dass Betroffene zwangsläufig ein Glaukom entwickeln“, sagt Professor Dr. med. Anselm Jünemann, Direktor der Klinik für Augenheilkunde der Universitätsmedizin Rostock. „Aber wenn Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte und Übergewicht zusammentreffen, ist eine Glaukom-Vorsorgeuntersuchung ab dem 40. Lebensjahr ratsam.“
Auch Schlaf-Apnoe gilt als Risikofaktor für den grünen Star – jeder zweite schnarchende Glaukom-Patient leidet am Schlaf-Apnoe-Syndrom, fanden Wissenschaftler heraus. Bei dieser Form des Schnarchens kämpfen die Betroffenen mit nächtlichen Atem-Aussetzern. „Der Sauerstoffmangel, der bei den Atemstillständen entsteht, scheint den Augen zu schaden“, erklärt Jünemann. „Ärzte sollten ihre Glaukompatienten deshalb fragen, ob sie schnarchen und womöglich tagsüber unter Müdigkeit leiden.“ Ob ein Schlaf-Apnoe-Syndrom vorliegt, das in jedem Fall mitbehandelt werden sollte, zeigt ein Test im Schlaflabor. Gegen die Atemaussetzer helfen Atemtherapiegeräte, Unterkieferschienen, aber auch Musizieren mit einem Blasinstrument und der Abbau von Übergewicht mit regelmäßiger Bewegung.
Damit wird körperliche Aktivität zu einem wichtigen Element auch in der Glaukomtherapie. Studien haben zeigen können, dass Sport den Augeninnendruck senkt. „Laufen oder Fahrradfahren kann den Augeninnendruck bei Glaukompatienten um bis zu 13 mmHg reduzieren“, so Jünemann. Zwar steigt der Druck anschließend wieder an. „Aber der Wiederanstieg ist um bis zu 50 Prozent verlängert“, erläutert Jünemann. Auch zügiges Gehen über 20 Minuten vermag den Augeninnendruck vorübergehend um 1,5 mmHg zu senken. Zum Vergleich: Ein Anstieg um einen mmHg erhöht das Risiko für einen Gesichtsfeldschaden um zehn Prozent. „Jeder Millimeter Absenkung zählt also“, betont Jünemann.
„Durch einen gesunden Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, Nikotinverzicht und regelmäßiger Bewegung können sich Risikopatienten womöglich nicht nur vor einem Herzinfarkt, sondern auch vor grünem Star schützen“, bilanziert DOG-Präsident Roider.
Diät-Produkte machen nicht schlank
Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie warnt vor Diät-Drinks & Co: Künstliche Süßstoffe könnten Diabetesrisiko erhöhen
Bochum – Synthetische Süßstoffe wie Aspartam und Saccharin sind Ersatzstoffe für Zucker und übertreffen sogar noch seine Süßkraft. Im Gegensatz zu Zucker enthalten sie keine Kalorien. Sie machen oder halten deshalb aber noch lange nicht schlank. Über eine Störung der Darmbakterien können sie sogar den Blutzucker erhöhen und damit das Diabetesrisiko steigern, zeigen Forschungsergebnisse aus Tierversuchen und an freiwilligen Versuchspersonen. Künstliche Süßstoffe sind nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) deshalb kein geeignetes Mittel, um das Gewicht zu halten oder gar um abzunehmen.
Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nimmt mehr Kalorien zu sich als sie verbraucht. Fettleibigkeit und der früher als Alterszucker bekannte Typ-2-Diabetes werden deshalb immer häufiger. „Gerade übergewichtige Menschen greifen häufig zu synthetischen Süßungsmitteln, um ihre Kalorienzufuhr zu drosseln“, berichtet der Endokrinologe Professor Dr. Klaus D. Döhler aus Hannover: „Die meisten machen die Erfahrung, dass sie wider Erwarten eher zu- denn abnehmen.“ Dies zeigen laut Professor Döhler auch die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien. „Mit Süßstoffen wird keine deutliche Gewichtsabnahme erzielt“, sagt der Experte: „Sie werden deshalb von Ärzten nicht als Diätmittel verordnet.“
Neu ist die Erkenntnis, dass die Süßstoffe den Zuckerstoffwechsel stören. Eine jüngst in „Nature“, einer der drei weltweit führenden wissenschaftlichen Zeitschriften, veröffentlichte Studie ergab: Bei Mäusen, denen häufig genutzte Süßstoffe wie Saccharin, Aspartam oder Sucralose ins Trinkwasser gegeben wurde, kam es nach kurzer Zeit im Glukosebelastungstest zu einem überhöhten Anstieg der Blutzuckerwerte. Für Professor Döhler ist dies ein ernst zu nehmendes Ergebnis: „Wir führen den Glukosebelastungstest zur Frühdiagnose des Typ-2-Diabetes durch. Ein Anstieg des Blutzuckers könnte deshalb bedeuten, dass Süßstoffe die Entwicklung der Zuckerkrankheit fördern“.
Darauf deuten laut Professor Döhler auch die Ergebnisse der laufenden ernährungsphysiologischen Studie „Personalized Nutrition Project“ hin: „Teilnehmer, die Süßstoffe verzehrten, wogen mehr, sie hatten höhere Werte im Nüchtern-Blutzucker und im Langzeit-Blutzucker HbA1c, und ihre Ergebnisse im Glukosebelastungstest waren gestört.“
Die ungünstige Wirkung der Süßstoffe scheint über eine Veränderung der Darmbakterien zustande zu kommen. „Die Süßstoffe begünstigen das Wachstum von Darmbakterien, die die Aufnahme von Zucker und möglicherweise auch von kurzkettigen Fettsäuren aus dem Darm steigern“, erläutert DGE-Mediensprecher Professor Dr. med. Dr. h. c. Helmut Schatz, Bochum: „Die regelmäßige Einnahme von Süßstoffen könnte deshalb die Nahrungsverwertung steigern.“
Süßstoffe, die nicht nur in „Diät“- oder „Light“-Getränken enthalten sind, sondern auch immer häufiger Fertignahrungsmitteln zugesetzt werden, galten – nach zeitweisen Vorbehalten – in den letzten Jahrzehnten als unbedenklich. „Diese Einschätzung kann so jetzt nicht mehr aufrechthalten werden“, meint Professor Schatz. „Übergewichtige Menschen, die mit Süßmitteln ihr Körpergewicht senken wollen, müssen wissen, dass sie nach den neuen Forschungsergebnissen damit möglicherweise ihr Diabetesrisiko sogar erhöhen“, fügt er hinzu. Um Übergewicht zu reduzieren, sollte die Ernährung ausgewogen sein, reichlich aus Obst und Gemüse sowie Zucker in Maßen bestehen und täglich um 500 Kilokalorien verringert werden. Dies entspreche der neuen S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Adipositas, an der auch die DGE mitgewirkt hat, betont Professor Schatz.
Literatur:
Suez J, Korem T, Zeevi D, Zilberman-Schapira G, Thaiss CA, Maza O, Israeli D, Zmora N, Gilad S, Weinberger A, Kuperman Y, Harmelin A, Kolodkin-Gal I, Shapiro H, Halpern Z, Segal E, Elinav E: Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut nicrobiota. Nature. 2014 Sep 17. doi: 10.1038/nature13793. Abstract
Shen J, Obin MS, Zhao L: The gut microbiota, obesity and insulin resistance. Mol. Aspects Med. 2013, 34 (1), 39-58
Schatz H: Adipositas-Leitlinie 2014: Gesamtkalorienzahl der Reduktionskost entscheidend, nicht deren Zusammensetzung. DGE-Blogbeitrag vom 4. Juli 2014.
Neuer Wirkstoff wird Patienten mit Diabetes mellitus in Deutschland künftig vorenthalten
Pressemitteilung
Deutsche Diabetes Gesellschaft kritisiert Entscheidung des G-BA zu Canagliflozin
Berlin, 26. September 2014 – Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), das Diabetesmedikament Canagliflozin nicht von den Krankenkassen erstatten zu lassen, scharf kritisiert. Der G-BA verhindere durch seine Entscheidung die Einführung einer neuen Gruppe von effektiven und sicheren Wirkstoffen, die für die Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes benötigt werden, erklärte DDG Präsident Privatdozent Dr. med. Erhard Siegel. Auf Grund des Beschlusses wird der Vertrieb in Deutschland nun eingestellt.
Canagliflozin ist nach Dapagliflozin der zweite Wirkstoff aus der Gruppe der SGLT-2-Hemmer („Gliflozine“), die den Blutzucker senken, indem sie die Ausscheidung von Zucker über die Nieren fördern. Im Juni vergangenen Jahres hatte der G-BA Dapagliflozin einen therapeutischen Zusatznutzen abgesprochen. Nun wurde auch die Verordnung von Canagliflozin auf Kassenrezept verhindert.
„SGLT-2-Hemmer sind eine wertvolle Bereicherung der therapeutischen Möglichkeiten, da sich der Wirkungsmechanismus von allen bisher verfügbaren Mitteln unterscheidet“, stellt Professor Dr. med. Dirk Müller-Wieland fest, Mediensprecher der DDG. Das Medikament komme deshalb insbesondere für Patienten infrage, die mit anderen Mitteln keine ausreichende Blutzuckersenkung erzielen und den Einsatz von Insulin vermeiden wollen. Bei diesen Patienten könne mit SGLT-2-Hemmern eine deutliche Senkung des Blutzuckerlangzeitwertes HbA1c erreicht werden. „Der G-BA versperrt mit seiner Entscheidung nun Kassenpatienten in Deutschland zum zweiten Mal diese Therapieoption“, kritisiert Siegel. „Canagliflozin ist für uns ein wertvolles Mittel in der Zusatztherapie für Patienten, das entsprechend den Zulassungsbedingungen allen Patienten zur Verfügung stehen sollte.“
SGLT-2-Hemmer senken nicht nur den Blutzucker, es kommt auch zu einem leichten Rückgang von Blutdruck und Körpergewicht. „Bei übergewichtigen Menschen mit Typ-2-Diabetes, die häufig einen zu hohen Blutdruck haben, ist dies ein günstiger Nebeneffekt, der langfristig Herzkreislauferkrankungen vorbeugen könnte“, sagt Siegel. „Wir betrachten Canagliflozin deshalb als geeignetes Mittel zur Monotherapie, wenn Ernährungsumstellung und Bewegung allein den Blutzucker nicht ausreichend senken und eine Anwendung von Metformin aufgrund von Unverträglichkeit oder Gegenanzeigen nicht möglich ist.“ Die Monotherapie sei nun vom Markt genommen, der Vertrieb der Substanz wird in Deutschland eingestellt.
Der G-BA stützt sich in seiner Entscheidung auf ein Gutachten des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), das nach Ansicht der DDG schwere Mängel aufweist. So hatte das IQWiG eine zentrale Zulassungsstudie aus methodischen Gründen nicht berücksichtigt. Die Studie hatte Canagliflozin mit dem Sulfonylharnstoff Glimepirid als Zusatztherapie bei Patienten untersucht, die mit Metformin allein keine ausreichende Blutzuckersenkung erzielen. In der Studie war die Dosis von Glimepirid langsam gesteigert worden, während Canagliflozin gleich in der vollen Dosis gegeben wurde. Das IQWiG interpretierte dies als unfairen Vergleich.
Aus Sicht der DDG ist es jedoch gängige Praxis. „Bei Sulfonylharnstoffen ist eine langsame Titrierung der Dosis üblich, da es unter der Therapie schnell zu Unterzuckerungen kommen kann“, erläutert Müller-Wieland. Bei SGLT-2-Hemmern besteht die Gefahr nicht. Dass es in der Studie trotz der Titration unter Glimepirid etwa sieben Mal häufiger zu Unterzuckerungen (Hypoglykämie) kam, ist für die DDG Experten ein klares Argument für den Einsatz von Canagliflozin. „Wir würden bei einem Patienten mit erhöhtem Hypoglykämierisiko immer einen SGLT-2-Hemmer bevorzugen“, sagt Müller-Wieland. Bedauerlicherweise seien Fachverbände wie die DDG bei der Beurteilung von neuen Wirkstoffen nicht konsultiert worden. „Fehleinschätzungen wie bei Canagliflozin könnten in diesem Fall verhindert werden“, betont Müller-Wieland.
Die DDG befürchtet zudem, dass die vom G-BA getroffenen Entscheidungen zum Zusatznutzen neuer Medikamente in der Behandlung des Typ-2 Diabetes künftig die Entwicklung von Monopolstellungen einzelner Substanzen fördern könnten. „Daran kann dem G-BA nicht gelegen sein“, meint Siegel.
Beschluss des G-BA:
https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/105/
Stellungnahme der DDG zum IQWiG-Gutachten:
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/Stellungnahmen/DDG_Stellungnahme_Canaglifozin_final_30062014.pdf
Tatsachen-Thriller Hot Zone
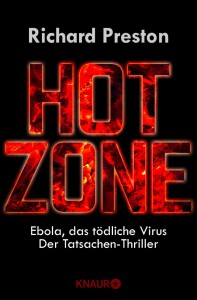 Fast stündlich laufen neue Meldungen zur in Westafrika grassierenden Ebola-Epidemie über den Nachrichtenticker. Mehrere tausend Menschen sind bereits gestorben, ein Vielfaches mehr erkrankt, die Seuche breitet sich unvermindert aus, die betroffen Länder versinken in Panik und Chaos.
Fast stündlich laufen neue Meldungen zur in Westafrika grassierenden Ebola-Epidemie über den Nachrichtenticker. Mehrere tausend Menschen sind bereits gestorben, ein Vielfaches mehr erkrankt, die Seuche breitet sich unvermindert aus, die betroffen Länder versinken in Panik und Chaos.
Aus diesem Anlass bringt der Droemer Knaur Verlag nun den Tatsachen-Thriller Hot Zone von Richard Preston in aktualisierter Fassung neu heraus. In seinem 1995 erschienenen Bestseller schildert der Wissenschaftsautor die Gefahr, die vom Ebola-Virus ausgeht, erschreckend nah an der heutigen Wirklichkeit. Die ebook-Ausgabe erscheint bereits am 29.09.2014, die Printausgabe folgt am 13.11.2014.
„Das Erschrecken ist groß, die Bedrohung real: Das Ebola-Virus breitet sich mit dramatischer Geschwindigkeit aus. Richard Preston hat vor 20 Jahren bereits den bahnbrechenden und immer noch gültigen Bestseller über die Entdeckung und Verbreitung des tödlichen Erregers verfasst. Aus aktuellem Anlass legen wir den Droemer-Knaur-Bestseller zur Buchmesse neu auf.“
Richard Preston
HOT ZONE
Ebola, das tödliche Virus
Der Tatsachen-Thriller
400 Seiten, € (D) 9.99
Erscheinungstermin Taschenbuch: 13.11.2014
Erscheinungstermin ebook: 29.09.2014
„Das erste Kapitel von Hot Zone ist das Schrecklichste, was ich je gelesen habe. Und dann wird es von Kapitel zu Kapitel immer noch schlimmer: Was für ein unglaubliches Buch!” Stephen King
Spannend und erschreckend von der ersten bis zur letzten Zeile
Ein brillant erzählter und wissenschaftlich fundiert Tatsachenthriller auf höchstem Informationsniveau
Mit einem brandaktuellen Vorwort und Lagebericht aus Westafrika von Richard Preston
Und einem Nachwort über die aktuelle Virengefahr von Horst Güntheroth, Wissenschaftsautor beim STERN
Der Nr. 1 Bestseller erschien 1995 bei Droemer Knaur und wurde in über 30 Sprachen übersetzt, in Deutschland 200.000 und weltweit über 2,5 Millionen Mal verkauft

