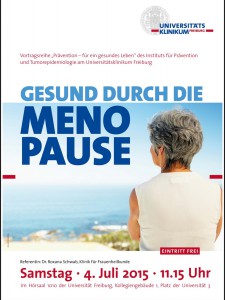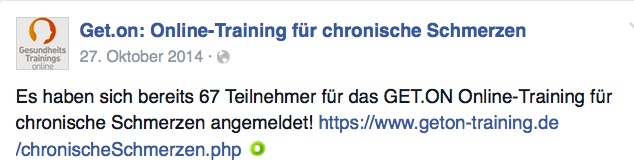Gesundheits-Apps sind allerorts beliebt.
 Die „Schlaganfall-App“ will in erster Linie helfen, die Zeichen für einen Schlaganfall schnellstens zu erkennen, um so die nötige Hilfe schnell herbeirufen zu können.
Die „Schlaganfall-App“ will in erster Linie helfen, die Zeichen für einen Schlaganfall schnellstens zu erkennen, um so die nötige Hilfe schnell herbeirufen zu können.
Da mit Hilfe von Gesundheits-Apps vor allem auch Daten gesammelt werden, wollten wir von der Deutschen Schlaganfall-Hilfe wissen, was mit den erfassten Daten passiert.
Hier die Antwort:
Durch die App werden unsererseits keine Daten erfasst oder weiterverwendet. Wenn der App-Nutzer von einer der integrierten Kontakt-Möglichkeiten (z.B. per E-Mail) Gebrauch macht, werden diese zwecks Bearbeitung der Anfrage an unsere Agentur und ggf. auch an uns weitergeleitet.
Um den Datenschutz richtig einschätzen zu können, sollte Nutzer wissen, dass Partner der App die „Initiative Schlaganfallvorsorge“ ist . Ihr gehören neben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) und der Schlaganfall-Hilfe die Pharmaunternehmen Pfizer und Bristol Myers-Squibb an. Die Initiative macht sich stark für die Prävention des Schlaganfalls durch bessere Informationen.
Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat ihre Schlaganfall-App überarbeitet. Nutzer können einen Schlaganfall-Verdacht prüfen und direkt den Notruf auslösen, auch im europäischen Ausland.
Drei einfache Fragen stellt der sogenannte FAST-Test, mit Audiobegleitung in drei Sprachen und Bildunterstützung. Durch einen Tastendruck lässt sich der Notruf 112 auslösen. Dieser funktioniert auch aus dem Mobilnetz in allen 28 EU-Staaten.
Zusätzlich hat die Deutsche Schlaganfall-Hilfe ihre im vergangenen Jahr entwickelte App um ein Infocenter erweitert. Es enthält Checklisten und vermittelt Wissen rund um den Schlaganfall. Wichtige Fragen für Angehörige und Patienten zum Aufenthalt auf einer Schlaganfall-Station (Stroke Unit) sind ebenfalls enthalten.
Eine weitere Neuheit ist das App-Center. Unter diesem Menüpunkt werden den Nutzern kostenlose medizinische Apps rund um das Thema Schlaganfall und Gesundheitsförderung neutral vorgestellt. Prüfen Sie genau, ob Sie weitere Apps – vor allem kostenlose – nutzen wollen. Jede App birgt auch das Risiko, dass mehr Daten als nötig erfasst werden.
Die App ist erhältlich im Apple Store und im Google Play Store unter dem Stichwort „Schlaganfall-Hilfe“. Weitere Informationen unter schlaganfall-hilfe.de/app.