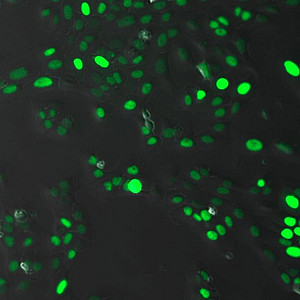Wie sich Zellverbände im Körper untereinander abstimmen
Berlin, 26.07.2021 Die zirkadiane Rhythmik ermöglicht ein zeitlich abgestimmtes Zusammenspiel von Organen und Organsystemen im Körper über den Tagesverlauf hinweg. Gesteuert wird diese innere Uhr bei Menschen und Säugetieren von einem Areal des Gehirns aus, dem Hypothalamus. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Charité – Universitätsmedizin Berlin haben nun einen weiteren, bislang unbekannten Mechanismus entschlüsselt, der für die Synchronität auf zellulärer Ebene sorgt und für die zeitliche Steuerung der Organfunktionen entscheidend ist. In der Fachzeitschrift Science Advances*beschreiben die Forschenden, wie zelluläre innere Uhren außerhalb des Gehirns miteinander kommunizieren und einen stimmigen Rhythmus auf Gewebsebene erzeugen.