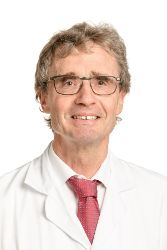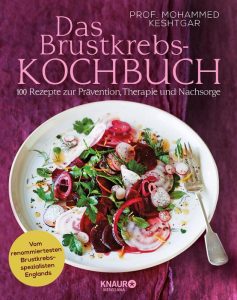Das schafft kein Arzt ohne Hilfsmittel: Dosierungen, spezifische Indikationen und Kontraindikationen von tausenden Medikamenten durchsuchen, Wechselwirkungen prüfen und die individuell beste Kombination für den Patienten zusammenstellen. Wenn der Patient gar wie knapp jeder zweite Deutsche über 65 Jahren fünf oder mehr Medikamente einnimmt, kann die individualisierte Therapie zur zeitraubenden Herausforder

Professor Dr. med. Walter E. Haefeli ist Ärztlicher Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg
ung werden. „Bei Polypharmazie erreichen die ärztlichen Entscheidungen eine solche Komplexität, dass ich mich frage, wie man sie ohne Hilfe im Kopf lösen will“, sagt Professor Walter E. Haefeli (Foto), Ärztlicher Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg. Der ausgewiesene Experte für Klinische Pharmakologie plädiert deshalb dafür, sich zum Wohle der Patienten von Computerprogrammen bei Entscheidungen zur Arzneimitteltherapie helfen zu lassen. In seiner Keynote-Lecture beim Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) in Frankfurt wird Haefeli die Herausforderungen im Umgang mit aktuellen Arzneimittelinformationssystemen detailliert erläutern. Außerdem wird er aufzeigen, wie die Verordnungen mithilfe von IT-Unterstützung in Zukunft sicherer werden und sich stärker an den Präferenzen der Patienten orientieren könnten.
Viele der gängigen Informationssysteme, die Ärzte und Apotheker bereits nutzen, um Verordnungen auf mögliche Wechselwirkungen und andere Risiken zu prüfen, haben aus Haefelis Sicht einen erheblichen Schwachpunkt: „Sie produzieren unzählige Warnungen, von denen die allermeisten auf den jeweiligen Patienten gar nicht zutreffen.“ Diese Programme, die im klinischen Alltag Entscheidungen unterstützen sollen, führen häufig vor allem zu einer Entscheidung: sie wieder abzuschalten. „In manchen Studien werden 95 Prozent der Warnungen, die das Programm ausgibt, weggeklickt“, kritisiert Haefeli. Für die Folge dieses unnützen Warnens gibt es bereits einen Begriff: „alert fatigue“. Auf Deutsch: Alarmmüdigkeit. Unpassende Gefahrenhinweise könnten zudem dazu führen, dass ein Medikament vorsorglich abgesetzt wird, obwohl es dem Patienten nützt.
Arzneimittelinformationssysteme müssen intelligenter werden
Haefeli weist zudem auf die Schwächen von verbreiteten Stand-alone-Systemen hin, die nicht an die Klinik- oder Praxissoftware angeschlossen sind. Sie könnten die Kofaktoren wie Begleiterkrankungen und aktuelle Laborwerte der Patienten nicht oder nur unzureichend berücksichtigen. Trotzdem rät der Klinische Pharmakologe zum Einsatz von Unterstützungssystemen. „Die Erfahrung zeigt, dass mithilfe des Computers eher evidenzbasiert behandelt wird“, sagt Haefeli, „weil Ärzte in diesen Situationen häufiger in der Literatur nachschlagen.“
Für die Zukunft wünscht sich Haefeli jedoch intelligentere IT-Unterstützung. Er forscht zusammen mit Kollegen an praxistauglichen Programmen. „Wir brauchen raffiniertere Software, die individualisierte Empfehlungen ausgibt“, so Haefeli. „Dafür muss sie tief in die Informationssysteme der jeweiligen Klinik oder Praxis integriert sein.“ Nur so könnten die Programme alle relevanten Daten des Patienten einbeziehen und dem Arzt Arbeit abnehmen. Dafür muss aber gewährleistet sein, dass entscheidungsrelevante Kofaktoren, wie zum Beispiel Allergien, verlässlich und maschinenlesbar kodiert und über Schnittstellen verfügbar sind.
Das funktioniert: Untertherapie vermeiden und zugleich Nebenwirkungen verringern
Ein ideales Unterstützungssystem würde laut Haefeli zuerst anhand der Diagnosen, Beschwerden und Präferenzen eines Patienten seine Therapiebedürftigkeit einschätzen und ermitteln, welche Medikamente zur Behandlung seiner Krankheiten infrage kommen. Anschließend würde es anhand eines möglichst vollständigen Medikationsplans prüfen, ob in den aktuellen Verordnungen ein notwendiges Medikament fehlt. Ein Programm mit dieser Funktionalität gebe es bislang nicht auf dem Markt, so Haefeli. Es sei aber notwendig, um Untertherapie zu vermeiden. Erst danach sollte das Programm Doppelverordnungen, Dosierungsfehler und Wechselwirkungen überprüfen. „Das Programm muss dabei nicht nur Wirkstoffpaare anschauen, sondern auch riskante oder interagierende Dreier- und Viererkombinationen.“ Außerdem müsse die Software auch Begleiterkrankungen wie Nierenfunktionsstörungen berücksichtigen und gegebenenfalls die Dosierungsempfehlung entsprechend anpassen.
Eine so individuell optimierte Therapie führt jedoch nicht zwangsläufig zu weniger Verordnungen, wie Haefeli betont: „Nicht die Zahl der Medikamente ist entscheidend für eine gute Behandlung, sondern die richtige Gesamtmedikation, die den Lebenszielen des Patienten am besten entspricht.“ Ziel sei es, die Nebenwirkungen für die häufig multimorbiden Patienten zu verringern. Dass dies möglich ist, wurde sowohl anhand der deutschen FORTA-Liste, einer Positiv- und Negativliste für die Arzneimitteltherapie älterer Menschen, als auch mit den in Irland entwickelten STOPP/START-Kriterien, eines Tools zur Vermeidung von Untertherapie und riskanten Verordnungen, bereits gezeigt. Dabei erhielten die Studienteilnehmer nach der Umstellung im Schnitt genauso viele Medikamente wie zuvor, vertrugen diese jedoch besser. Allerdings ist eine solche händische Überarbeitung des Medikationsplans zeitaufwändig. „Für die FORTA-Liste dauert die Anpassung pro Patient etwa eine halbe Stunde“, so Haefeli. „Mit Software ginge das schneller. Der Arzt könnte in der gewonnenen Zeit andere Fragen klären, zum Beispiel die ständig wechselnden Therapieziele seines Patienten.“
Der Nutzen neuer Systeme muss durch Studien belegt werden
Für die meisten der derzeit angewandten oder in Entwicklung befindlichen Unterstützungssysteme fehlen bislang gute Studien, die ihren Nutzen belegen. In einem ersten Schritt müssen Entwickler zeigen, dass ihr System so arbeitet wie vorgesehen. Anschließend müssen Studien belegen, dass die Anwender, also Ärzte und Apotheker, sich in ihren Entscheidungen von dem Hilfsprogramm beeinflussen lassen. „Für viele Systeme wurde dieser zweite Schritt gar nicht geprüft“, sagt Haefeli. In einem dritten Schritt sollte schließlich überprüft werden, ob die technische Entscheidungshilfe den Patienten einen Vorteil bringt. „Dabei kommt es auf Endpunkte an, die für geriatrische Patienten relevant sind“, so Haefeli, „also die Lebensqualität oder die Frage der Autonomie, also ob ein Umzug ins Pflegeheim vermieden werden kann. Solche Endpunkte wurden bislang in Studien aber kaum untersucht und sind selten das Behandlungsziel in Leitlinien.“
Auf dem Weg zu besseren Unterstützungssystemen für die ärztliche Entscheidungsfindung erhofft sich Haefeli einen Impuls aus der aktuellen Forschung zur Krebsbehandlung. In der Onkologie werden bereits heute für ausgewählte Patienten maßgeschneiderte Therapien mit Computerhilfe zusammengestellt. Das dort gewonnene Know-how müsse man auch in die Routineanwendung für andere Patientengruppen übertragen, so Haefeli.
Zur Person
Professor Dr. med. Walter E. Haefeli ist Ärztlicher Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg. Nach dem Medizinstudium in Basel und Weiterbildungsaufenthalten an den Universitäten Stanford und Harvard habilitierte er sich 1995 an der Universität Basel in Innerer Medizin. 1999 wurde Haefeli auf den Lehrstuhl für Klinische Pharmakologie an der Universität Heidelberg berufen. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen die Erforschung von Arzneimittelwechselwirkungen und die Entwicklung von Techniken zur Individualisierung von Arzneimitteltherapien, unter anderem hinsichtlich der Bedürfnisse des einzelnen Patienten. Zur Bearbeitung dieser Herausforderungen forscht Haefeli bevorzugt nach IT-basierten Lösungen.
Termin:
Professor Walter E. Haefeli, Universitätsklinikum Heidelberg
Keynote-Lecture: „IT-Unterstützung bei Polypharmazie – Herausforderungen, Hoffnungen und Träume”
DGG-Jahreskongress
Campus Westend – Hörsaal 4
Donnerstag, 28. September 2017, 14:15-15:00 Uhr
Frankfurt am Main