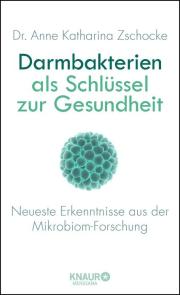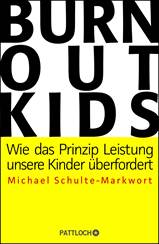Neueste Erkenntnisse aus der *Mikrobiom-Forschung
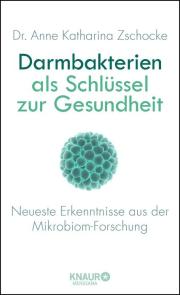 „Bisher hielten die meisten Menschen Bakterien für Krankheitserreger, doch seit Kurzem gibt es in der Forschung revolutionäre Erkenntnisse: Bakterien haben eine große Bedeutung für den gesunden Organismus – ohne sie werden wir tatsächlich krank. Damit ändert sich das bisherige Verständnis für die Zusammenhänge im menschlichen Körper völlig. In zahlreichen Studien wurde wissenschaftlich exakt nachgewiesen, was zuvor höchstens praktisch erfahrbar war: Darmbakterien sind der Schlüssel zur Gesundheit.“ – So die treffende Kurzbeschreibung des Verlages.
„Bisher hielten die meisten Menschen Bakterien für Krankheitserreger, doch seit Kurzem gibt es in der Forschung revolutionäre Erkenntnisse: Bakterien haben eine große Bedeutung für den gesunden Organismus – ohne sie werden wir tatsächlich krank. Damit ändert sich das bisherige Verständnis für die Zusammenhänge im menschlichen Körper völlig. In zahlreichen Studien wurde wissenschaftlich exakt nachgewiesen, was zuvor höchstens praktisch erfahrbar war: Darmbakterien sind der Schlüssel zur Gesundheit.“ – So die treffende Kurzbeschreibung des Verlages.
In ihrem Buch beschreibt Dr. Anne Katharina Zschocke ausführlich, weshalb ein gesunder Darm für uns so wichtig ist. Dabei sollte man sich nicht von den zahlreichen Fachbegriffen abschrecken lassen, die mal mehr mal weniger häufig auftauchen. Wer den Lesefluss nicht unterbrechen möchte, markiert sich am besten die Begriffe, um sie später nachzuschlagen oder wirft schnell mal einen Blick in den Anhang. Dort wird allerdings nur ein Teil der Begriffe erklärt. Für den Rest gibt es Wikipedia.
Dass man derartige Bücher auch allgemein verständlicher schreiben kann, hat Giulia Enders mit ihrem Buch „Darm mit Charme“ bewiesen.
Menschen mit akuten Darmproblemen empfehle ich beide Bücher, um sich so einen guten Überblick zu verschaffen, wie sie ihren Darm wieder ins Gleichgewicht bringen können.
Das Reizdarmsyndrom
Das Reizdarmsyndrom ist mehr oder weniger eine Diagnose der Hilflosigkeit, da sie nicht wirklich ein echtes Krankheitsbild beschreibt. Wenn Ärzte die Ursache für die Beschwerden nach schulmedizinischen Erkenntnissen nicht finden können, dann bekommen Patienten bestenfalls die Diagnose „Reizdarm gestellt“. Oft werden sie auch ohne Befund nach Hause geschickt und ihrem Schicksal selbst überlassen.
Wenn diese Patienten immer und immer wieder bei ihrem Hausarzt vorsprechen, dann folgt meist die Diagnose „psychosomatische Beschwerden“.
Wer allerdings über einen langen Zeitraum keinerlei Hilfe erfährt, ist unter Umständen auch für eine Depression anfällig, weil ein kranker Darm auch aufs Gemüt schlägt. Leider wird diese Möglichkeit äußerst selten von Ärzten und Therapeuten in Betracht gezogen. Da werden schon eher Psychopharmaka verordnet, um der Situation Herr zu werden. Und das kann bei Patienten mit einer geschädigten Darmflora zur Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes führen, weil Psychopharmaka die Darmflora weiter schädigen.
Betroffene Patienten sollten deshalb genau prüfen lassen, was der tatsächliche Auslöser für ihre Erkrankung ist. Eine ärztliche Zweitmeinung kann hier von großem Nutzen sein.
Kopf oder Bauch?
An den Gedanken, dass wir auch ein unabhängiges Bauchgehirn haben, müssen wir uns erst noch gewöhnen.
Das berühmte „Bauchgefühl“, das noch immer gerne verspottet wird, ist damit endgültig rehabilitiert.
Wenn wir krank sind, wollen wir schnellstmögliche Heilung. Wer eine Erkältung hat, weiß, dass diese mit Medikamenten 1 Woche dauert und ohne 7 Tage. Und dennoch kaufen die Deutschen schon bei den geringsten Anzeichen einer Erkältung gerne Pillen, Säfte und Salben, um schnellstens wieder gesund zu werden. Viel schlimmer ist jedoch, dass viele Ärzte immer noch gerne ein Antibiotikum verabreichen, obwohl es hier nachweislich keinen Nutzen hat, aber unter Umständen großen Schaden anrichten kann. Antibiotikum heißt wörtlich übersetzt „gegen das Leben“.
Anne Katrin Zschocke schreibt: „Ist es nicht erstaunlich, dass die Menschheit zum Mond fliegt, aber sich im eigenen Bauch so erbärmlich wenig auskennt, dass man als Heilmittel das krasse Gegenteil von etwas entwickelte, was tatsächlich heilsam wäre? Wer erkrankt ist, braucht eine bessere Bakterienversorgung – und erhält stattdessen ein Mittel für ihre Beseitigung.“
Nicht an allem ist die Pharmaindustrie schuld
Dass dies so ist, ist ausnahmsweise nicht nur der Pharmaindustrie geschuldet – auch nicht den Krankenkassen, die lieber Geld für ein Antibiotikum ausgeben als für eine wirksame Alternativbehandlung. Dem Ganzen liegt ein Denkfehler zu Grunde, der – dank neuester Forschungsergebnisse – revidiert werden muss. Das dauert bekanntlich seine Zeit, ehe es in den Köpfen der Mediziner ankommt.
Dies ist auch der Grund, weshalb viele Patienten auch heute noch einen langen Leidensweg vor sich haben. Das fängt damit an, dass es nicht ganz einfach ist, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, der bzw. die sich intensiv mit dem Thema Darmbakterien auseinandergesetzt hat. Hinzu kommt, dass die hier notwendigen Stuhluntersuchungen nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Das gilt auch für die Aufbaupräparate, die gebraucht werden, wenn die Untersuchung eine Schädigung der Darmflora ergibt. Zu guter letzt ist die Geduld des Patienten gefragt. Denn ein Aufbau der Darmflora kann viele Monate dauern.
Gesundes Essen hilft beim Heilungsprozess
Meist geht die Behandlung mit einer Essensumstellung einher. Denn Fast Food in Form von Tütensuppen, Burger, Döner, Currywurst, Chips, Schokoriegel, süßen Limonaden, viel Alkohol etc. tragen nicht zur Heilung bei. Der Verzicht auf Fleisch und Geflügel aus Massentierhaltung ist schon deshalb wichtig, weil in der Massentierhaltung gerne Antibiotika eingesetzt werden. Das gilt auch für Fisch aus Aquakulturen.
Die Antibiotika gelangen über Fleisch und Fisch in unseren Körper und können dort eventuell die Darmflora schädigen oder zu einer Antibiotikaresistenz führen.
Ein gesunder Darm ist viel wichtiger als bislang angenommen. Wir sollten ihn deshalb ganz schnell aus der Schmuddelecke herausholen. Giulia Enders hat auf unterhaltsame Weise damit angefangen.
Trauen Sie sich: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl!
„Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit“
Neueste Erkenntnisse aus der *Mikrobiom-Forschung
Von Dr. Anne Katharina Zschocke, erschienen Knaur – Menssana
Hardcover, 03.11.2014, 368 S., €19,99 als E-Book 17,99
ISBN: 978-3-426-65753-9
Dr. Anne Katharina Zschocke studierte Medizin und Naturheilverfahren in Freiburg und London. Nach klinischer Tätigkeit wechselte sie das berufliche Metier und wandte sich dem praktischen Gartenbau zu, um sich fortan ganz der Natur, Kultur und Themen des Paradigmenwechsels zu widmen. Seit 2001 unterrichtet sie die praktische Anwendung von Effektiven Mikroorganismen und ist im deutschsprachigen Raum zu diesem Thema die führende Kapazität. Sie wird als Referentin weltweit zu Vorträgen und Seminaren zu EM eingeladen.
Wikipedia: Das *Mikrobiom bezeichnet im engeren Sinne die Gesamtheit aller den Menschen, oder andere Lebewesen (z. B. Regenwürmer) besiedelnde Mikroorganismen. Damit werden primär die Darmbakterien (Darmflora) in Verbindung gebracht, aber auch alle Mikroorganismen, die auf der Haut (Hautflora) oder anderen Körperteilen (Mundhöhle, Schleimhäute, Genitalorgane etc.) leben. Im weiteren Sinne können auch die mikrobiellen Gemeinschaften anderer Habitate (Boden, Blattoberflächen, Wohnung u.v.m.) begrifflich eingeschlossen sein.
Der Begriff wurde von Joshua Lederberg in Anlehnung an das Genom geprägt, da er nach Beendigung des Humangenomprojekts behauptete, dass auch die Mikroflora des Menschen berücksichtigt werden müsse, da dieses Teil des menschlichen Stoffwechselsystems sei und daher maßgeblichen Einfluss auf den Menschen habe.
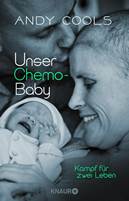 Lesley Verney ist gerade zehn Wochen schwanger, da erfährt die Dreiunddreißigjährige, dass sie eine aggressive Form von
Lesley Verney ist gerade zehn Wochen schwanger, da erfährt die Dreiunddreißigjährige, dass sie eine aggressive Form von Die Plazenta schützt nach der zwölften Woche das Kind, so dass eine Chemotherapie bei Lesley und eine eventuelle Operation ohne Schaden für das Kind möglich ist. Armant rät ihnen, das Kind zu behalten. Die beiden fassen Vertrauen zu den Ärzten und gehen das Risiko ein. Für Lesley beginnt eine Odyssee zwischen Gynäkologie und Onkologie, auf der Andy sie durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Und der neunmonatige unermüdliche Kampf wird mit einem Wunder gekrönt. Marnix, ihr Sohn, kommt gesund und kräftig zur Welt. Inzwischen ist er drei Jahre alt und geht in die Vorschule. Lesley hat bis heute hat keinen Rückfall erlitten.
Die Plazenta schützt nach der zwölften Woche das Kind, so dass eine Chemotherapie bei Lesley und eine eventuelle Operation ohne Schaden für das Kind möglich ist. Armant rät ihnen, das Kind zu behalten. Die beiden fassen Vertrauen zu den Ärzten und gehen das Risiko ein. Für Lesley beginnt eine Odyssee zwischen Gynäkologie und Onkologie, auf der Andy sie durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Und der neunmonatige unermüdliche Kampf wird mit einem Wunder gekrönt. Marnix, ihr Sohn, kommt gesund und kräftig zur Welt. Inzwischen ist er drei Jahre alt und geht in die Vorschule. Lesley hat bis heute hat keinen Rückfall erlitten. realistischer, packender Bericht, der Frauen Mut machen soll, die während ihrer Schwangerschaft an Krebs erkranken. Er beschreibt in seinem Buch die Zeit zwischen Hoffnung und Verzweiflung, die er mit seiner Frau Lesley durchlitt.
realistischer, packender Bericht, der Frauen Mut machen soll, die während ihrer Schwangerschaft an Krebs erkranken. Er beschreibt in seinem Buch die Zeit zwischen Hoffnung und Verzweiflung, die er mit seiner Frau Lesley durchlitt.