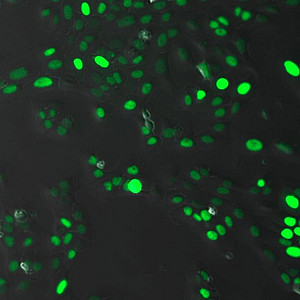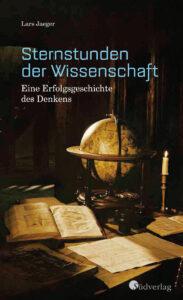Methode ermöglicht natürlicheres Ergebnis nach Brustkrebs-OP
Forscher des Universitätsklinikums Freiburg haben ein neues Verfahren entwickelt, mit dem das Brustvolumen vor einer Operation besser als bisher ermittelt werden kann
Bei Patientinnen, bei denen aufgrund von Brustkrebs ein Teil oder das gesamte Brustgewebe entfernt werden musste, stellt der plastisch-chirurgische Wiederaufbau der Brust einen integralen Bestandteil der Behandlung dar. Um ein möglichst natürliches Aussehen zu erreichen, sollte sich das Volumen der gesunden und der rekonstruierten Brust möglichst gleichen. Nun haben Ärzte des Universitätsklinikums Freiburg ein neues Computermodell entwickelt, mit dem das Volumen der Brüste wesentlich präziser als bisher ermittelt werden kann. Dadurch können die Ärzte die Operation besser planen, der Eingriff dauert kürzer und das Ergebnis entspricht noch mehr einem natürlichen Aussehen. Die zugrundeliegende Studie erschien am 25. November 2020 im Fachmagazin PLOS One.
„Für viele Frauen ist es ein wichtiger Schritt, nach einer Brustkrebsbehandlung wieder ihr natürliches Aussehen zurückzugewinnen. Mit der neuen Methode können wir diesen Wunsch noch besser erfüllen“, sagt PD Dr. Filip Simunovic, Oberarzt an der Klinik für Plastische und Handchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg. Aber auch Frauen mit Fehlbildungen der Brüste oder mit Brüsten ungleicher Größe können von dem Verfahren profitieren.
Um das Volumen zu schätzen, wird ein 3D-Streifenlichtoberflächenscan der Brüste gemacht. Bisher war es allerdings lediglich ungenau möglich, aus diesem 3D-Datensatz das Volumen präzise zu berechnen, weil die hintere Begrenzung der Brust, die Brustwand, im 3D-Scan nicht erfasst wird.
Dieses Problem konnte Michael Göpper im Rahmen seiner Doktorarbeit an der Klinik für Plastische und Handchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg lösen. Er etablierte eine Methode, welche auf statistischen Formenmodellen beruht und eine Schätzung der Brusthinterwand ermöglicht. „Mit Hilfe dieser Methode erhalten wir eine zuverlässige und präzise Messung des Brustvolumens bei unseren Patientinnen“, sagt Prof. Dr. Björn Stark, Ärztlicher Direktor der Klinik für Plastische und Handchirurgie am Universitätsklinikum Freiburg. „Mit der Veröffentlichung können jetzt plastische Chirurgen weltweit das Verfahren einsetzen und so das Behandlungsergebnis der Patientinnen verbessern“, so Stark.
Originaltitel der Studie: Improved accuracy of breast volume calculation from 3D surface imaging data using statistical shape models
DOI: 10.1371/journal.pone.0233586
Link zur Studie: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233586