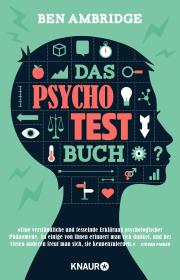Ob rot, gelb oder grün: Egal in welcher „Ampelfarbe“ Sie Paprika bevorzugen. Alle Paprika-Sorten haben eines gemeinsam – sie sind wahre Schatzkammern für Ihre Gesundheit.

Foto: obx-medizindirekt
Regensburg (obx-medizindirekt) – Welches Obst und Gemüse enthält am meisten Vitamin C? Die meisten Menschen antworten spontan: Orangen und Zitronen. Das ist falsch. Königin des Vitamin C ist die Paprika. Ihr Vitamin C pro 100 Gramm liegt zwischen 120 und 400 Milligramm. Bei Zitronen sind es lediglich 34. Deshalb liefern Paprikas selbst in gedünsteter Form noch mindestens viermal so viel Vitamin C wie Zitrusfrüchte. Paprika signalisiert in allen „Ampelfarben“, in grün, in gelb und selbst in rot: freie Fahrt für Gesundheit.
Paprikas kommen aus Ungarn – auch diese landläufige Meinung ist falsch. Paprika ist zwar aus der ungarischen Küche nicht mehr wegzudenken, die Ungarn haben die Paprika einst ebenfalls importiert: aus Mexiko. Heute zählt die Paprika als Gemüse und das Pulver als wichtigstes Würzmittel zu den klassischen Zutaten für berühmte ungarische Spezialitäten: von Kesselgulasch bis Pörkölt, von Schmorfleisch bis paprizierte Schweinerippen, Rostbraten und Letscho.
In Sachen Gesundheit ist die Paprika eine wahre Schatzkammer. Zu den Inhaltsstoffen zählt beispielsweise das Vitamin P, das heute nicht den Vitaminen, sondern den gesundheitlich wichtigen sekundären Pflanzenstoffen, den Oligomeren Procyanidinen (OPC) zugerechnet wird. OPC sollen die Gesundheit der Blutgefäße fördern, weil sie ihre Durchlässigkeit regeln.
Dieses „Vitamin P“ kann die Blut- und Lymphgefäße stärken, den Aufbau von Bindegewebe unterstützen, Entzündungen und Allergien entgegenwirken und den Hormonhaushalt normalisieren helfen. Im Zusammenspiel mit Vitamin C werden alle diese Wirkungen noch verstärkt. Und Paprika enthält beides reichlich.
Paprika gibt es heute in den unterschiedlichsten Formen – von spitz über dreieckig und trapezförmig bis kugelig – in allen Maßen – von der Größe eines Fingernagels bis zur Faustgröße – und allen Schärfegraden – von süß bis brennend scharf. Der Capsaicin genannte Stoff, der die Schärfe ausmacht, gilt als besonders anregend auf sämtliche Verdauungsdrüsen. In der Medizin wird er sogar als Schmerzmittel, zum Beispiel bei Gürtelrose, eingesetzt. Paprika-Gewürzpulver führt ebenso wie der Verzehr von Gemüsepaprika zur Verbesserung einer gesunden Bakterienbesiedelung im Darm.
Paprikas haben das ganze Jahr Saison, vor allem dann, wenn Freilandsalate nicht zu haben sind. Grüne Paprika sind noch unreife Schoten, die relativ wenig Aroma aufweisen. Gelbe, orangefarbene und rote bis auberginenfarbene Schoten sind reifer und werden wegen ihres aromatischen Geschmacks bevorzugt in Salaten verwendet.
In seiner Ursprungsheimat Mexiko lässt sich die Geschichte des auch in gemäßigten Zonen wachsenden tropischen Nachtschattengewächses bis auf tausend Jahre zurückverfolgen. Paprika gedeiht vor allem in Regionen, in denen ausreichend Licht und Wärme zur Verfügung stehen. Deshalb können nur fünf Prozent des deutschen Verbrauchs aus einheimischen Züchtungen gedeckt werden.
Das steckt in der Paprika (jeweils pro 100 Gramm)
Vitamin C 120 bis 400 mg
Vitamin B1 9,07 mg
Vitamin B2 0,07 mg
Niacin 0,40 mg
Vitamin E 0,70 mg
Kalium 213 mg
Kalzium 10 mg
Magnesium 12 mg
Kalorien 24 kcal
Was sie so scharf macht
Ein Stoff namens Capsaicin ist es, der den Chilischoten, einer Sonderform der Paprika, die Schärfe verleiht. Es sitzt vor allem in den weißlichen Scheidewänden im Inneren der Chilis, weniger im roten Fruchtfleisch. Der Schärfegrad von Paprikas wird auf einer Skala von 0 bis 10 eingeteilt: Gemüsepaprikas haben 0, Peperoni und Peperoncini 3 bis 6, Cayenne und Piripiri 7 bis 9. Zehnergrade wie die Sorten Habanero oder Scotch Bonnet sind hierzulande kaum gefragt.
Das Schärfegefühl beim Essen entsteht, weil das Capsaicin an den Schleimhautzellen Rezeptoren beeinflusst, die Hitzeschmerzen wie bei Verbrennungen auslösen. Allerdings entsteht nur das Gefühl einer Verbrennung, keine wirkliche Verletzung. Aber es stimmt dann natürlich, wenn man sagt: „Diese Chilis brennen wie die Hölle.“
Paprika aus Spanien ist immer wieder wegen hoher Belastungen von Pestiziden in die Kritik geraten. Es ist wichtig, dass man auf die Herkunft achtet.