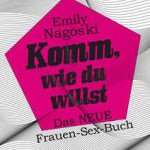Endoprothetik-Experten raten Trägern zu „Wohlfühl“-Sportarten
Kein Sportverbot bei Kunstgelenken
Freiburg – Die Hälfte der Deutschen treibt Sport – Träger von Kunstgelenken gehörten lange nicht dazu. Wenn die ersten warmen Frühlingstage wieder Radfahrer und Nordic Walker ins Freie locken, hindern jedoch auch eine künstliche Hüfte oder ein neues Kniegelenk nicht an sportlichen Aktivitäten. Studien zeigen, dass bestimmte Sportarten wie Radfahren und Schwimmen sich mit Kunstgelenken gut vertragen, und die Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik e.V. (AE) rät den Patienten dazu, regelmäßig Sport zu treiben. Einige Regeln sollten sie dabei beachten und sich zuvor mit ihrem Arzt abstimmen, so die AE.
Träger eines neuen Kunstgelenks sind damit oft nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder schmerzfrei. Viele Aufgaben des Alltags lassen sich wieder leichter erledigen und die Freude an der Bewegung kehrt zurück. Orthopäden und Unfallchirurgen unterstützen sie dabei, nach der Devise: Wer gehen kann, kann auch Sport treiben. Untersuchungen der letzten Jahre zeigen, dass Menschen mit Kunstgelenken sogar belastungsintensive Sportarten wie Skifahren, Tennis, Bergwandern oder Rudern sicher betreiben können. In den ersten sechs Monaten nach der Operation müssen insbesondere die Patienten, welche mit zementfrei implantierten Prothesen versorgt wurden, zurückhaltend sein, meint Professor Dr. med. Karl-Dieter Heller, Chefarzt an der Orthopädischen Klinik Braunschweig: „Der Knochen braucht die Zeit, um eine feste Verbindung zur Endoprothese aufzubauen“, sagt der Generalsekretär der AE. Er rät Patienten, diese Zeit für Krankengymnastik und Muskelaufbautraining zu nutzen. Zunächst sollten Menschen mit Kunstgelenken jene Sportarten vorziehen, die sie aus früheren Zeiten kennen, denn, so Heller: „Routine und Erfahrung mit vertrauten Bewegungsabläufen verhindern, dass es zu Verletzungen kommt und oft sind das das auch die Sportarten, in denen sich Patienten sicher und wohl fühlen.“ Körperliches Training und Muskelaufbau haben einen sehr hohen Stellenwert, um dem alterungsbedingten Muskelabbau vorzubeugen.
Bisher fürchteten Ärzte, dass Kunstgelenke sich durch Sport lockern und schneller verschleißen. „Wir gingen lange davon aus, dass körperliche Schonung die Stabilität des Kunstgelenks verbessert und die Tragezeiten verlängert“, sagt Heller. Wissenschaftlich belegt war dies jedoch nicht. Studien haben jedoch gezeigt, dass der Verzicht auf Sport die Gesundheit der Patienten nicht fördert. „Bewegungsmangel ist eine wichtige Ursache für chronische Erkrankungen, die auch den Knochen betreffen“, sagt auch Professor Dr. med. Heiko Reichel, Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik am RKU Ulm. Dazu gehört auch Knochenschwund im Alter, Osteoporose. Sie gefährdet die Verankerung der Kunstgelenke im Knochen. „Sport kann sich hier günstig auswirken und möglicherweise sogar die Tragezeit der Kunstgelenke verlängern“, fügt der Präsident der AE hinzu. Hinzu kommt, dass mangelnde Fitness eine häufige Ursache für Stürze und Knochenbrüche ist. Schon Stolpern belaste die Kunstgelenke stärker als die meisten Sportarten, erklärt der Orthopäde: „Am besten ist das Kunstgelenk geschützt, wenn trainierte Muskeln und straffe Bänder es umgeben.“
Gut geeignet sind sogenannte „Low-Impact“-Sportarten, die das Kunstgelenk nicht durch plötzliche Stöße belasten. Hierzu gehören Wandern, Nordic Walking, Schwimmen, Skilanglauf, Radfahren, Gymnastik, Rudern und Golf. Bedingt geeignet sind Tennis, Tischtennis, Kegeln, Bergwandern, alpiner Skilauf in Schontechnik und nur unter bestimmten Voraussetzungen leichtes Jogging. Ungeeignet sind Sportarten, bei denen es zu plötzlichen Drehbewegungen, extremen Abspreizungen, plötzlichen oder dauerhaften Belastungsspitzen kommt. Dazu gehören Marathon, Fußball, Handball, Basketball oder Volleyball. Auch Kampfsportarten, Hoch- und Weitsprung, Wasserski und Felsklettern sind nichts für Menschen mit Kunstgelenken.
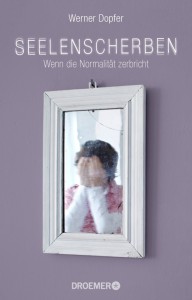 Die unfassbare Tat eines Piloten, der 149 Menschen mit in den Tod riss, löst in der Presse eine Debatte über Schuld aus. Kann man einen psychisch kranken Menschen für seine Tat verantwortlich machen? Anneli Tiirik, die durch den Absturz der German Wings Maschine die Liebe ihres Lebens verloren hat, tut es nicht. Sie sagt: „Ich kann niemanden dafür hassen, dass er krank ist“.
Die unfassbare Tat eines Piloten, der 149 Menschen mit in den Tod riss, löst in der Presse eine Debatte über Schuld aus. Kann man einen psychisch kranken Menschen für seine Tat verantwortlich machen? Anneli Tiirik, die durch den Absturz der German Wings Maschine die Liebe ihres Lebens verloren hat, tut es nicht. Sie sagt: „Ich kann niemanden dafür hassen, dass er krank ist“.